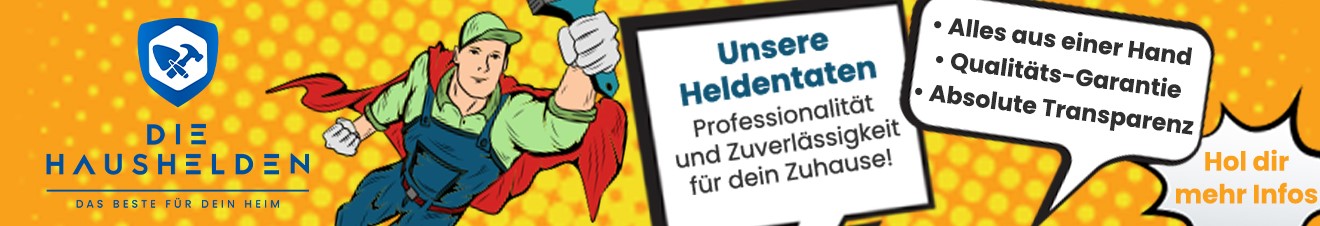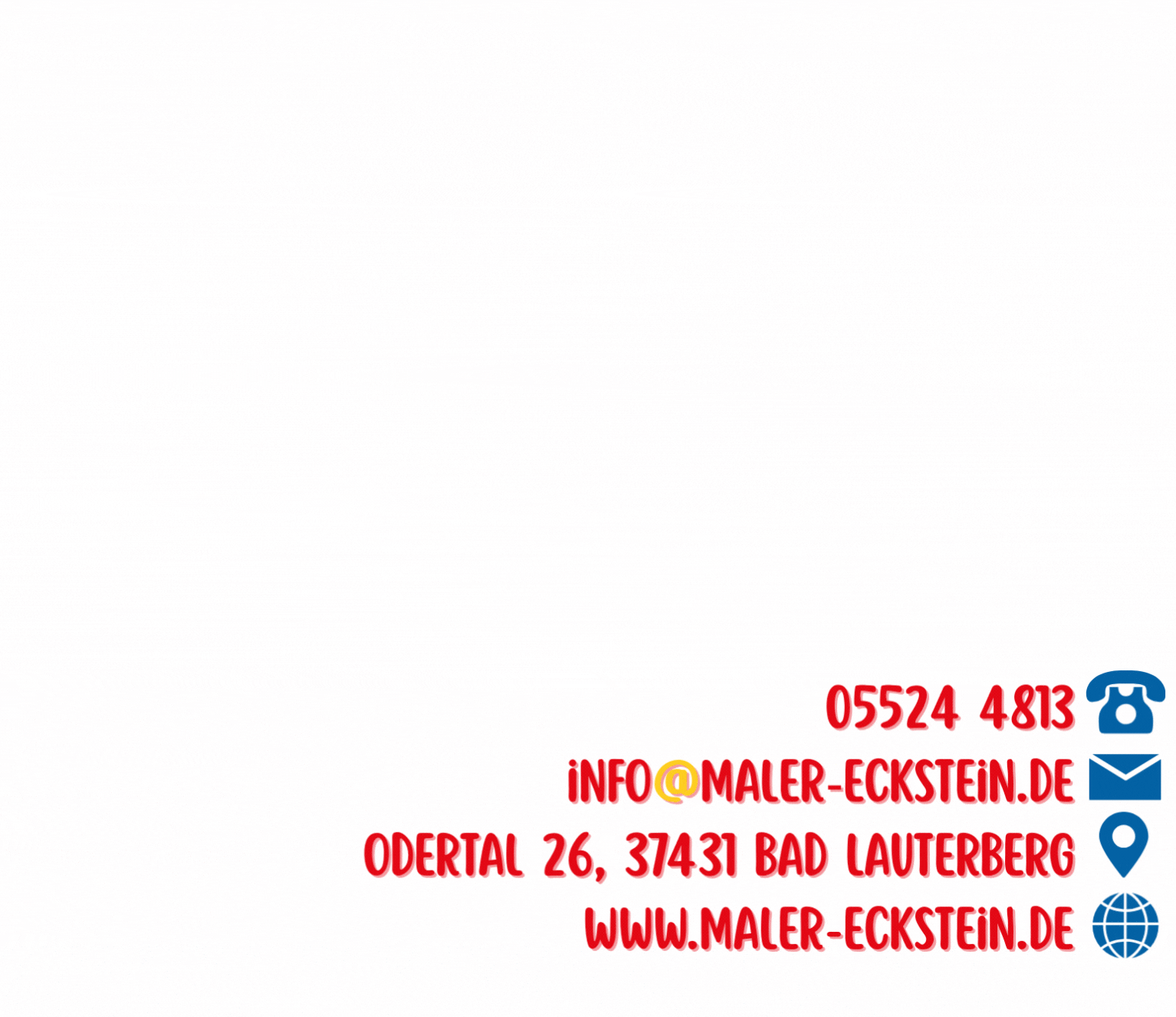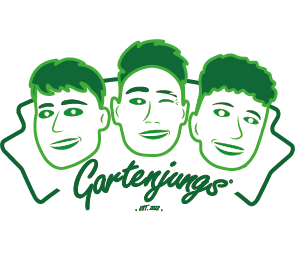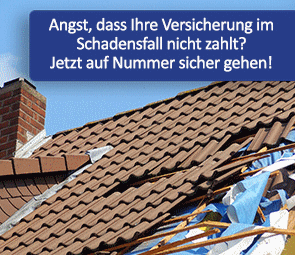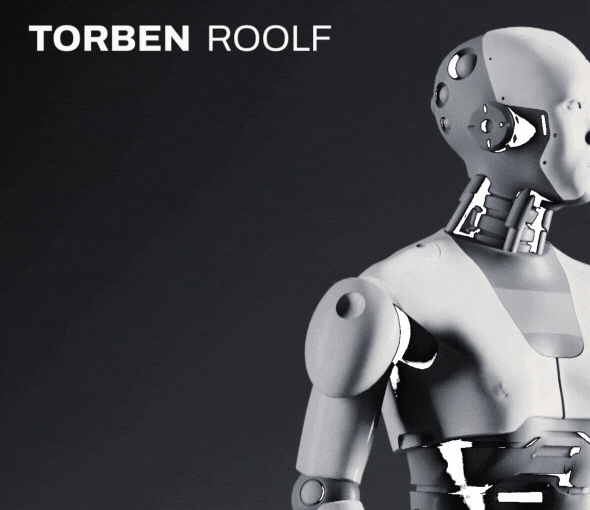Am 8. Mai 1945 endete der Zweite Weltkrieg – ein Einschnitt, der auch im Altkreis Osterode und im Harz mit Gewalt und Zerstörung einherging. Restverbände der Wehrmacht und der Waffen-SS versuchten, den Vormarsch der US Army zu stoppen. An vielen Orten erinnern heute Kriegsgräber an diese letzten Kämpfe. Ein Multi-Media-Vortrag des Historikers Bernd Langer beleuchtet, wie sich das Kriegsende und der demokratische Neubeginn in der Region konkret vollzogen.
Die Veranstaltung findet am Sonntag, 11. Mai 2025, um 15 Uhr im Gasthaus Deutscher Kaiser in Herzberg am Harz statt. Veranstalter ist der Verein Bunt statt Braun Osterode e. V., der Eintritt ist frei.
Umstrittener Begriff: Befreiung
Der Begriff „Befreiung“ für den 8. Mai 1945 hat sich erst über Jahrzehnte hinweg etabliert. Für politisch und rassistisch Verfolgte war das Kriegsende zweifellos eine Befreiung. Auch aus Sicht anderer europäischer Länder war 1945 der Abzug der deutschen Besatzer ein Befreiungsakt. In Deutschland selbst jedoch überwogen bei vielen Zeitzeugen andere Eindrücke: Der militärische Zusammenbruch, persönliche Verluste, Heimatverlust durch Flucht und Vertreibung prägten das Bild des 8. Mai. Selbst ohne Sympathien für das NS-Regime stand für viele das eigene Schicksal im Vordergrund. Die Wehrmacht wurde häufig nicht mit NS-Verbrechen in Verbindung gebracht, sondern galt als „verführt“ und selbst Opfer der Verhältnisse.
Politische Deutung im Wandel
Lange Zeit wurde der 8. Mai offiziell als „Stunde Null“ oder „Zusammenbruch“ bezeichnet. Erst 1985 sprach Bundespräsident Richard von Weizsäcker in einer viel beachteten Rede erstmals vom „Tag der Befreiung“. Der Begriff wurde lange Zeit auch mit der ideologischen Sichtweise der Sowjetunion in Verbindung gebracht, die den 8. Mai nicht nur als Sieg über den Faschismus, sondern auch über den Kapitalismus deutete.
Mit dem politischen Wandel nach 1990 – dem Ende der Sowjetunion und dem Zusammenschluss von BRD und DDR – rückte ein gemeinsames antifaschistisches Selbstverständnis stärker in den Vordergrund. Dies trug maßgeblich zur weiteren Verbreitung des Begriffs Befreiung bei.
Erinnerungskultur im Wandel
Ein Beispiel für den veränderten Umgang mit der Vergangenheit ist das sogenannte „Soldatengrab“ bei Bad Lauterberg. 1955 von einem Lehrer und Schülern als symbolischer Ort für gefallene deutsche Soldaten errichtet, wurde es jahrzehntelang kaum hinterfragt. Im Jahr 2020 wurde die verwahrloste Anlage vom Harzklub Zweigverein neu gestaltet. Heute erinnert dort ein schlichtes Holzkreuz mit Informationstafel an den Einsatz für Frieden und gegen Rassismus. Der Name „Soldatengrab“ wurde beibehalten, da der Ort als Wanderziel bekannt ist.
Die Lehren aus dem NS-Regime
Zum demokratischen Neubeginn nach dem Krieg gehörte auch die strafrechtliche Aufarbeitung der NS-Verbrechen. Mit den Urteilen der Nürnberger Prozesse am 30. September und 1. Oktober 1946 wurden zentrale Akteure des NS-Regimes verurteilt – ein wichtiger Schritt in der Entnazifizierung und ein Signal für einen neuen politischen Anfang.
Fotos: Volker Fleig 2014