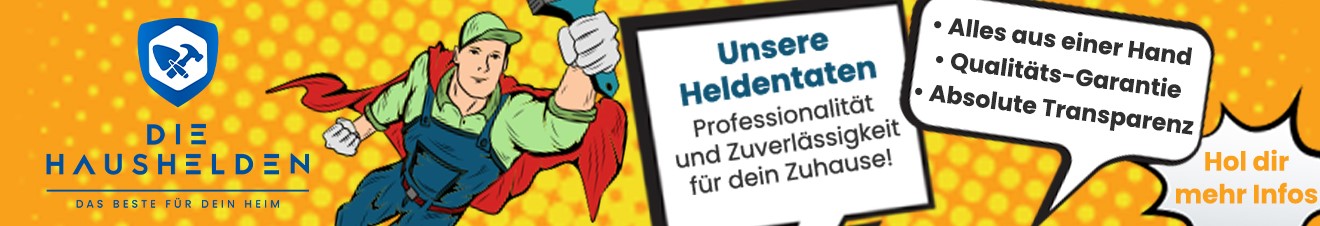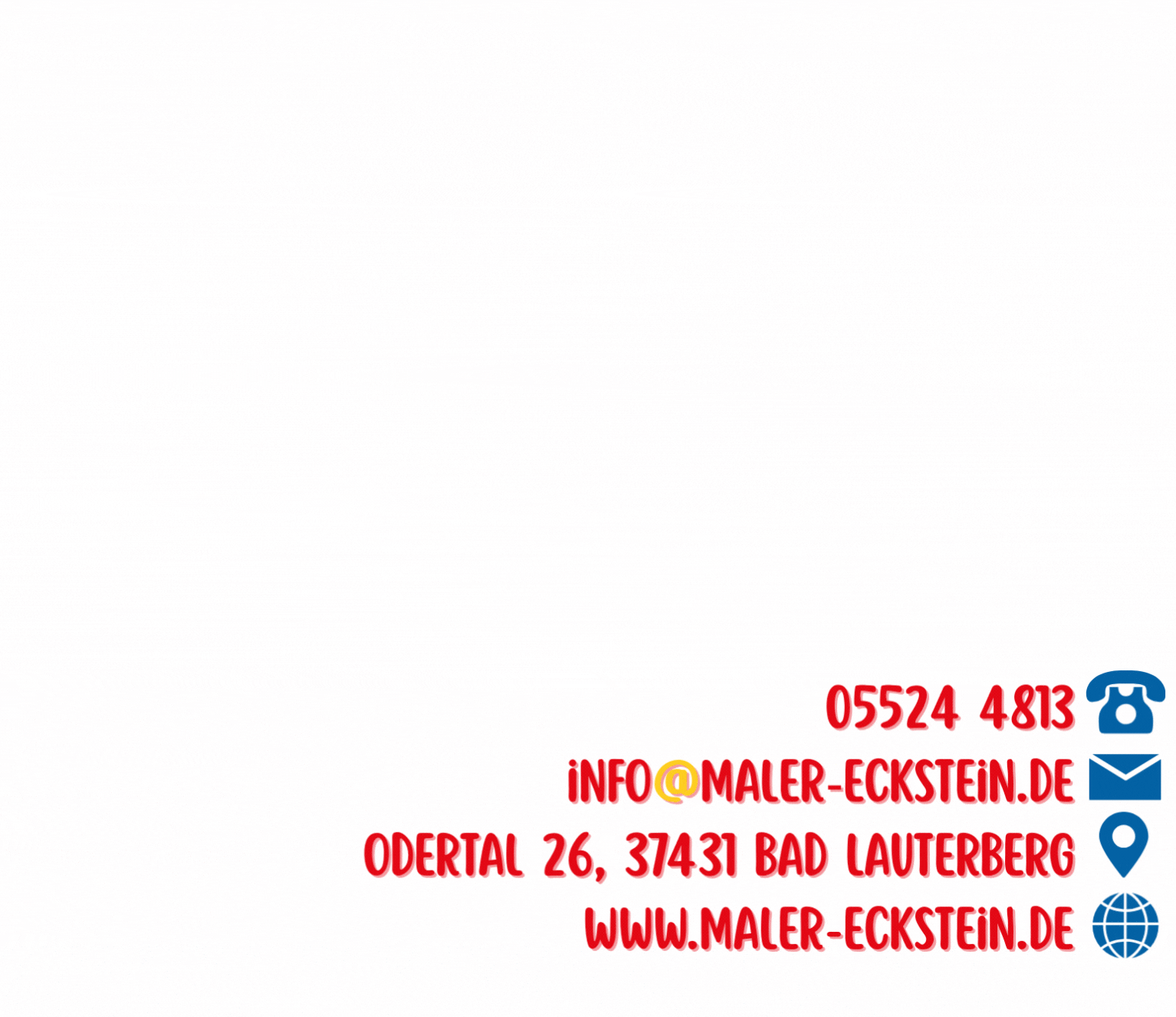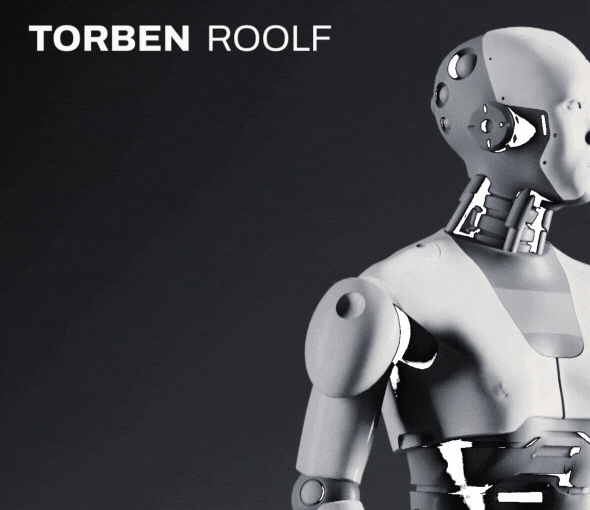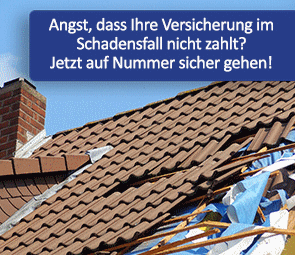Deutschland ist ins neue Speicherjahr mit vergleichsweise niedrigen Füllständen gestartet. Anfang April lagen die Speicher nur bei etwa 29 % der Kapazität. Im Verlauf des Sommers wurde weiter eingespeichert, doch der Fortschritt ist schleppend.
Derzeit (Sommer/Herbst 2025) sind nach Marktbuchungen etwa 70 % der Speicherleistung gebucht. Allerdings gilt: Technisch ist eine vollständige Befüllung (100 %) bis zum 1. November nicht mehr realistisch. Experten warnen, dass 70 % Füllstand im Falle eines sehr kalten Winters nicht ausreichen würden, um durchgehend sicher zu versorgen.
Die deutschen Gasvorräte dürften unter typischen oder milden Winterbedingungen in Kombination mit Importen, Einsparungen und staatlichen Maßnahmen im Großen und Ganzen ausreichen, um eine stabile Versorgung zu gewährleisten.
Jedoch ist der Puffer relativ eng: Bei einem extrem kalten Winter könnten die Vorräte schneller erschöpft sein, als es momentan kalkuliert ist. Die Unsicherheiten sind größer als in „normalen“ Jahren, und strategische sowie politische Maßnahmen werden entscheidend sein, um Risikofälle abzufangen.
Ob die Vorräte reichen oder nicht, hängt von zahlreichen Faktoren ab. Hier sind die wichtigsten:
· Lieferungen aus Norwegen, den Niederlanden, Belgien etc. spielen eine entscheidende Rolle.
· Gasimporte per LNG (verflüssigtes Erdgas) können zusätzliche Flexibilität bringen und Spitzenlasten abfangen.
· Der Marktmechanismus ist jedoch kompliziert: In manchen Fällen ist Gas im Sommer teurer als im Winter („negativer Sommer-Winter-Spread“), was die wirtschaftliche Motivation zur Einspeicherung senkt.
· Das sogenannte Gasspeichergesetz und staatliche Vorgaben versuchen, durch regulatorische Eingriffe die Einspeicherung zu forcieren.
Wie sieht das Verbrauchsniveau aus und was bringen Einsparungen?
Der tatsächliche Verbrauch hängt davon ab, wie stark Haushalte, Industrie und Gewerbe verbrauchen bzw. einsparen: Wenn der Verbrauch konservativ und effizient gehalten wird (z. B. durch Energiesparen, bessere Dämmung), dann sinkt der Druck auf die Vorräte.
Eine plötzliche Nachfragewelle (z. B. durch extrem kalte Tage) kann jedoch die Reserve schnell schrumpfen lassen. Im Notfall könnten staatliche Maßnahmen greifen, um Engpässe zu vermeiden:
Staatliche Vorratsstrategien oder strategische Einspeicherungsinstrumente könnten aktiviert werden. Importverträge oder Subventionen können angepasst werden, um ausländische Quellen stärker zu nutzen.
Einschätzung: Reichen die Vorräte für einen kalten Winter?
Unter normalen Bedingungen sind die Vorräte wahrscheinlich ausreichend. Wenn der Winter durchschnittlich oder mild ausfällt, könnten die derzeitigen Vorräte zusammen mit Importen und Einsparungen ausreichen, um die Versorgung sicherzustellen. Viele Szenarien (z. B. von INES) prognostizieren, dass unter solchen Bedingungen sogar der gesetzlich vorgeschriebene Mindestfüllstand von 30 % im Februar 2026 erreichbar sein könnte.
Auch jüngste Analysen wie die der LBBW kommen zu dem Schluss, dass Deutschland im aktuellen Zustand durch den Winter kommen dürfte – auch bei Verzicht auf russische Lieferungen.
Bei einem extrem kalten Winter wird es kritisch Wenn die Temperaturen stark unter dem historischen Mittel liegen, könnte der Gasverbrauch so stark steigen, dass die Vorräte schneller als gedacht aufgebraucht sind. In solchen Fällen warnen Experten, dass eine sichere Versorgung langfristig nicht garantiert ist. Einige Speicherbetreiber warnen explizit, dass unter extremen Bedingungen eine Mangellage droht. Die Tatsache, dass technisch keine vollständige Speicherbefüllung mehr möglich ist und dass der Marktmechanismus derzeit wenig Anreiz zur Einspeicherung bietet, erhöht das Risiko. Auch die Warnungen aus der Praxis und Medienberichte über „unzureichende Vorräte“ zeigen, dass das Vertrauen in eine durchgehende Versorgung bei extremen Bedingungen begrenzt ist.