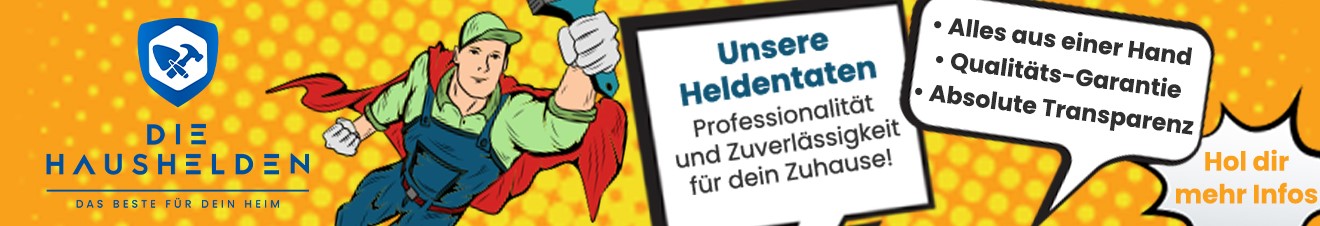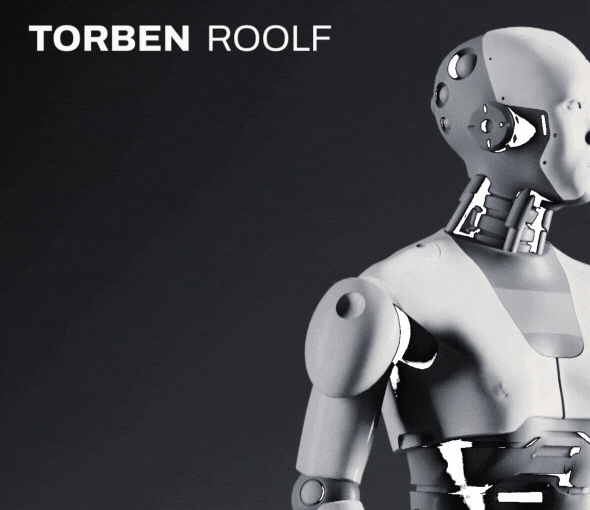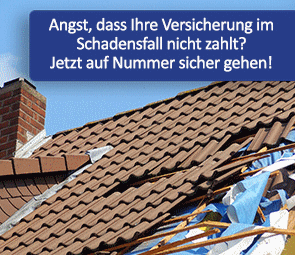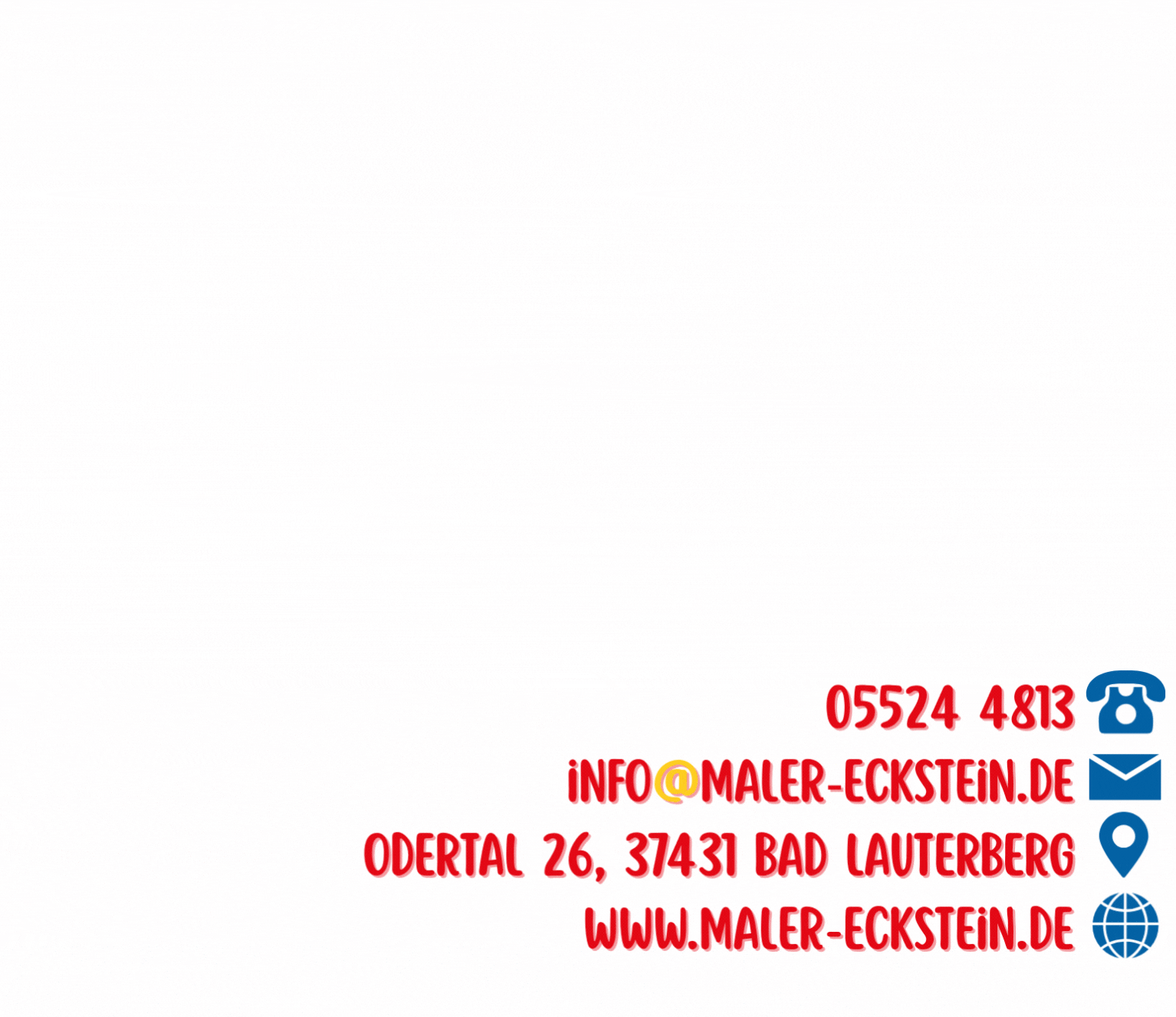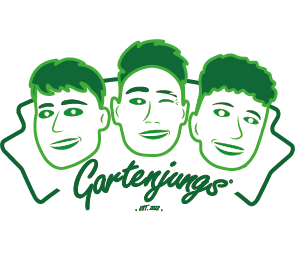Wälder, die sich natürlich und weitgehend ohne menschlichen Einfluss entwickeln, führen nicht zu einer Zunahme von Störungen – das belegt eine aktuelle Studie, die Forschende der Technischen Universität München (TUM) im Wissenschaftsmagazin „Journal of Applied Ecology“ veröffentlicht haben. Die Wissenschaftlerinnen haben deutschlandweit Waldstörungen durch Borkenkäferbefall, Windwurf oder Dürre in aktiv bewirtschafteten und auf stillgelegten Flächen untersucht. Dabei verglichen sie Wirtschaftswälder mit Waldschutzgebieten vergleichbarer Artenzusammensetzung, Klimasituation und Geländeform. 314 solcher rund 20 Hektar großen „Paare“ aus bewirtschafteten Wäldern und seit mindestens 35 Jahren unter Schutz gestellten Wäldern gingen in die Studie ein.
Waldstörungen nehmen im Klimawandel weltweit zu und stellen die Waldbewirtschaftung vielerorts vor große Herausforderungen. Gleichzeitig gilt die Stilllegung von Wäldern und das Zulassen einer natürlichen Dynamik ohne Einfluss des Menschen für den Naturschutz als zentraler Ansatz, um dem Verlust der biologischen Vielfalt entgegenzuwirken. Die auch von Deutschland ratifizierte globale Biodiversitätsrahmenkonvention, unterzeichnet im Jahr 2022 in Montreal, sieht daher die Schaffung weiterer Schutzgebiete vor. „Die vermutete Zunahme natürlicher Störungen wird jedoch oft als Argument gegen die Schaffung neuer Waldreservate angeführt. Groß angelegte Studien zum Störungsregime in Waldschutzgebieten im Vergleich zu bewirtschafteten Wäldern fehlten jedoch bisher. Aus einem solchen Vergleich können auch wichtige Hinweise zur künftigen Behandlung von Wäldern abgeleitet werden“, so die Erstautorin der Arbeit, Kirsten Krüger von der TUM.
„Unsere zentrale Forschungsfrage lautete: Sind Wälder ohne Bewirtschaftung tatsächlich stärker von Störungen durch Wind, Borkenkäfer und Dürre betroffen als aktiv bewirtschaftete Wälder?“, erläutert Prof. Rupert Seidl, Forschungsleiter im Nationalpark Berchtesgaden und Leiter des Lehrstuhls für Ökosystemdynamik und Waldmanagement an der TUM, der die Studie leitete. Er fasst zusammen: „Für Deutschland lautet die Antwort eindeutig: Nein.“ Krüger ergänzt: „Auf Basis von Satellitendaten für die Jahre 1986 bis 2020 konnten wir nachweisen, dass nutzungsfreie Waldschutzgebiete durchschnittlich eine um 22 Prozent geringere Störungsrate und eine um 32 Prozent geringere Störungsstärke aufwiesen als vergleichbare, aktiv bewirtschaftete Wälder. Der Unterschied zwischen Waldreservaten und Wirtschaftswäldern war dabei vor allem in Jahren mit extremen Stürmen oder Dürren stark ausgeprägt.“
Aus den Forschungsergebnissen lassen sich nach Ansicht der Forschenden wichtige Erkenntnisse ableiten: „Schutzgebiete können in unsere Waldlandschaften integriert werden, ohne die Gefahr durch Störungen zu erhöhen. Dies bestätigt nicht zuletzt auch den Erfolg des in Deutschland praktizierten Schutzgebietsmanagements. Gleichzeitig können wir gerade nach Störungen zusätzlich zum aktiven Management auch natürliche Prozesse der Reorganisation nutzen, um unser Ziel von strukturierten und diversen Wäldern zu erreichen“, so Seidl.
Die Forschungsergebnisse sind bundesweit von großer Relevanz für Schutzgebiete wie Nationalparks, Wildnisgebiete, Naturwaldreservate und andere ungenutzte Waldflächen. Auch Peter Südbeck, Vorstandsvorsitzender von Nationalen Naturlandschaften e. V. – dem Dachverband der deutschen Nationalparks, Wildnisgebiete und Biosphärenreservate – begrüßt die Resultate: „Das Zulassen natürlicher Dynamik in Wäldern ist ein zentrales Element zum Erhalt der biologischen Vielfalt in diesen Lebensräumen. Dass der Naturschutzgrundsatz ‚Natur Natur sein lassen‘ nicht zu verstärkten Waldstörungen führt, kann zur Versachlichung vieler Diskussionen rund um unsere von Wald geprägten Großschutzgebieten beitragen.“
Foto: Rupert Seidl