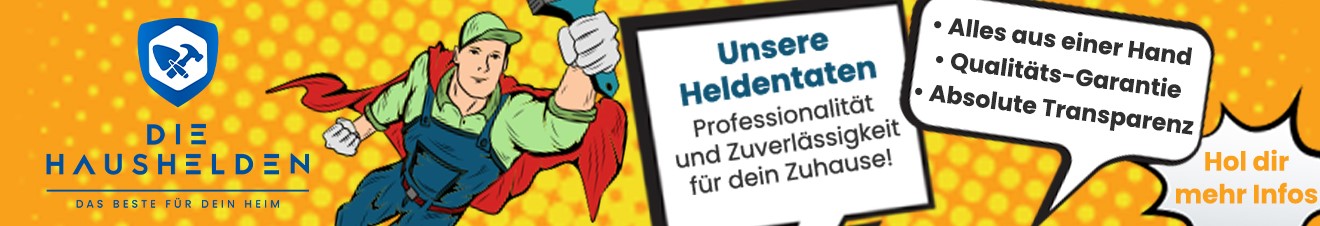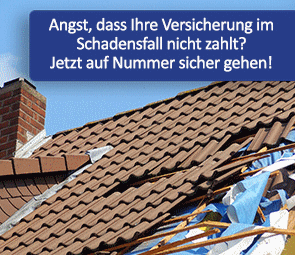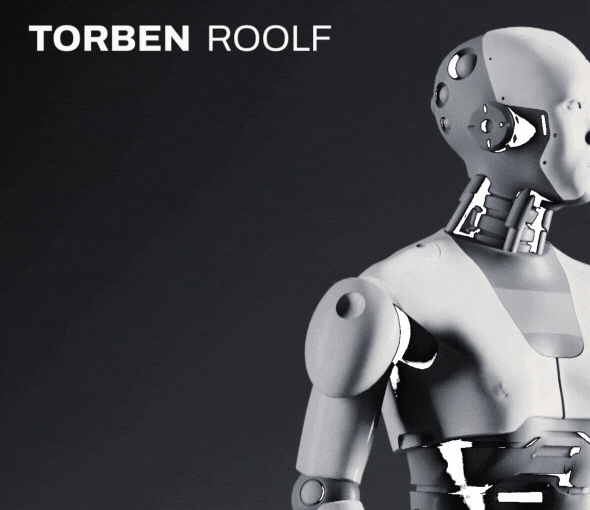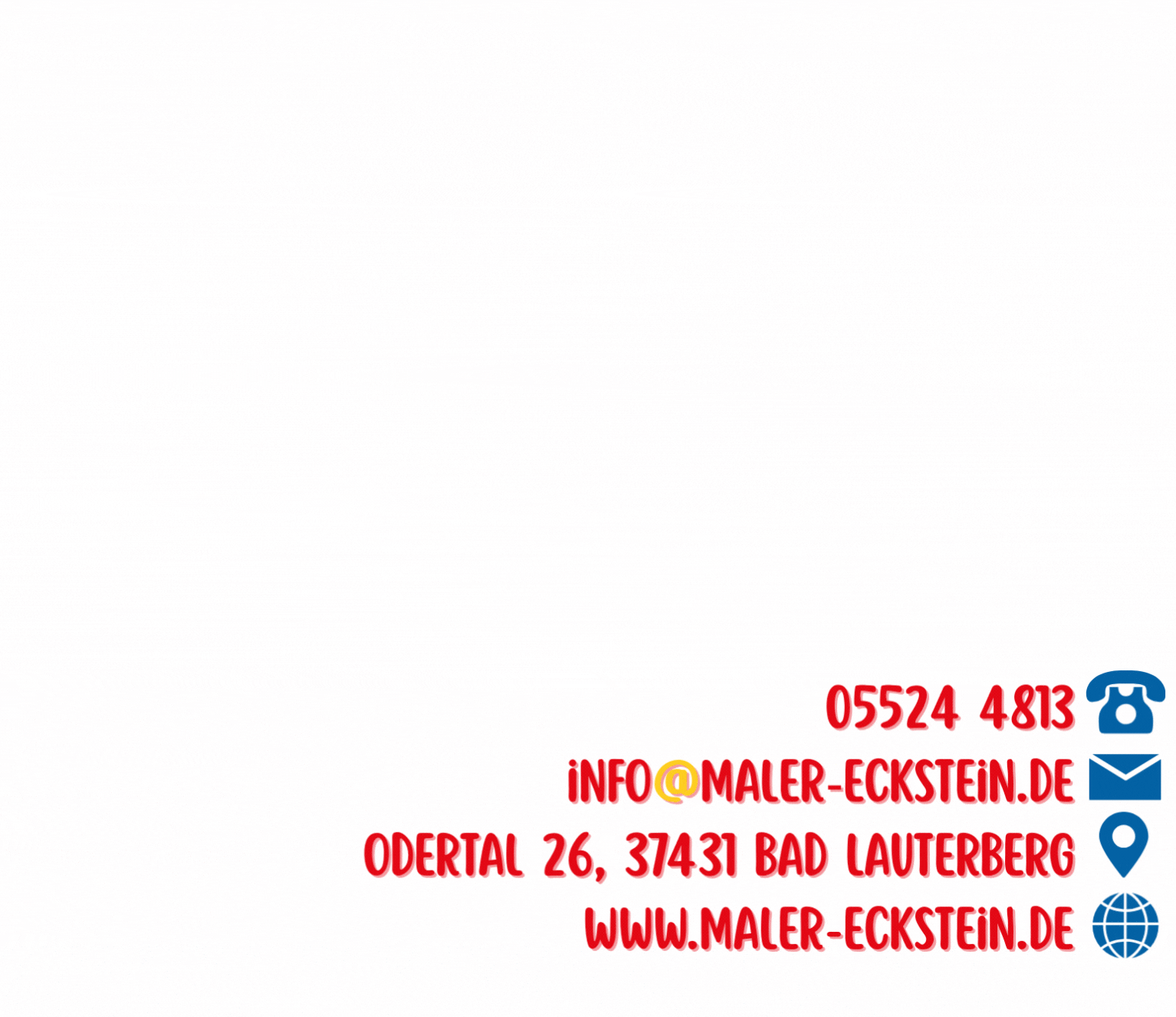Weit ins graue Altertum hinein verliert sich der Ursprung der Stadt Quedlinburg; denn schon zur Zeit der alten Sachsen stand an der gleichen Stelle ein Dorf, Quitlingen genannt, und die Sachsenherzöge pflegten hier mit Vorliebe des edlen Weidwerks. Noch bevor Heinrich I., der Finkler, zum deutschen König gewählt worden, war schon Quedlinburg sein liebster Aufenthaltsort, dem er auch als König die Treue bewahrte. Hier soll ihm der Sage nach die Krone überbracht worden sein, als er auf dem Finkenherd mit Vogelfang beschäftigt war.
Manch seltsame Kuriosität aus tausendjähriger Geschichte hat sich in Quedlinburg bewahrt: so zum Beispiel ein gedörrtes Menschenhaupt und zwei rechte Hände, denen der Daumen fehlt. Es sollen Überreste von Leichnamen der gegen den Sohn Heinrichs, Kaiser Otto I. Verschworenen sein, welche im Jahre 924 hingerichtet wurden. Weiter finden wir dort höchst interessante alte Waffen, darunter eine Kanone von besonderer Konstruktion, Folterwerkzeuge, Urnen aus den alten Begräbnisplätzen der Sachsen, einen Kodex des Sachsenspiegels sowie einen gewaltigen, solide gezimmerten Holzkasten. Nur eine kleine Tür führt in sein Inneres, durch die sich ein Mensch nur mit großer Not zwängen kann. Von diesem Kasten weiß die Sage eine besondere Bewandtnis.
Im 14. Jahrhundert war Graf Albert von Reinstein der Schutzvogt von Quedlinburg. Er entstammte einem alten Grafengeschlecht und war es gewohnt, seinen Willen durchzusetzen. Auf das Quedlinburger Krämerpack blickte er höhnisch herab. Das missfiel den stolzen Quedlinburgern, die sich durch immer neue Steuern des »Raubgrafen« gedemütigt fühlten. So kam es zu offener Fehde. In der bezog auch der Bischof von Halberstadt Partei für die Quedlinburger.
Darüber erbittert, besetzten die Grafen von Reinstein die Höhen um Quedlinburg sowie das Kloster Wiperti und die Warte auf der Altenburg, nahmen Bürger gefangen, störten den Handel der Stadt und schadeten derselben, wo sie nur konnten. Die Bürger ihrerseits machten Ausfälle gegen die Reinsteiner, welche meistens siegreich waren. Nun verbanden sich aber die Reinsteiner mit den Grafen von Anhalt, Mansfeld und Hohenstein und bedrängten die Stadt nur umso mehr.
Da beschlossen die Bürger, ein Letztes zu wagen, um sich von diesen Drangsalen zu befreien. Unterstützt von den Mannen des Bischofs brachen sie an einem Sommertag des Jahres 1336 aus der Altstadt hervor und schlugen die Reinsteiner nach einem verzweifelten Kampfe. Graf Albert von Reinstein, der die Bürger besonders hart bedrängte, indem er die Neustadt besetzt hatte, wurde aus dieser verjagt. Er wandte sich zur Flucht und versuchte nach dem Kloster Wiperti zu entkommen. Am Hackelteich aber strauchelte sein Ross und er wurde gefangen genommen und im Triumphzug zum Marktplatz geschafft. Dort sperrte man ihn in den vorsorglich extra angefertigten Holzkäfig. Über ein Jahr hielt man ihn dort gefangen. Die Hansestädte verlangten seine Hinrichtung und verurteilten ihn als einen Störer des Landfriedens; der Kaiser bestätigte dieses Urteil.
Dennoch kam es – wohl in letzter Minute – nicht zur Ausführung. Denn Graf Albert erlangte unter der Bedingung seine Begnadigung, dass er der Schutzgerechtigkeit entsagen, die Stadtmauern ausbessern und sieben Türme in derselben erbauen lassen wolle. Das hierüber ausgestellte Dokument enthält die Schlussworte: »Gegeben to Quedlinburg vor der Stadt.« Nach diesem Wortlaut scheint es, als wäre der Graf schon auf den Richtplatz vor die Stadt geführt worden, ehe er sich entschlossen hätte, auf diese Bedingungen einzugehen.
Der Kasten aber, worin Raubgraf Albert gefangen saß, seine Streitaxt, Armbrust, Sporen und Feldflasche werden noch heute auf dem Rathaus zu Quedlinburg aufbewahrt.
Foto: pixabay