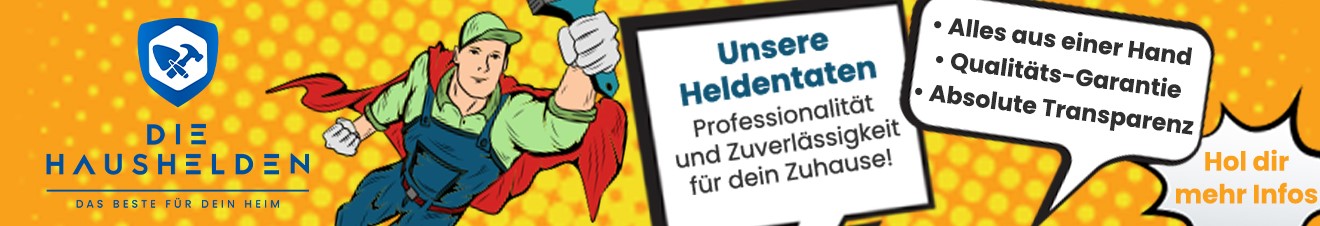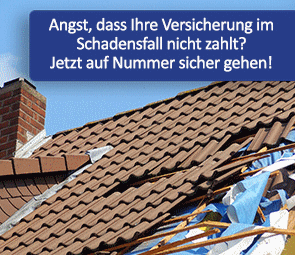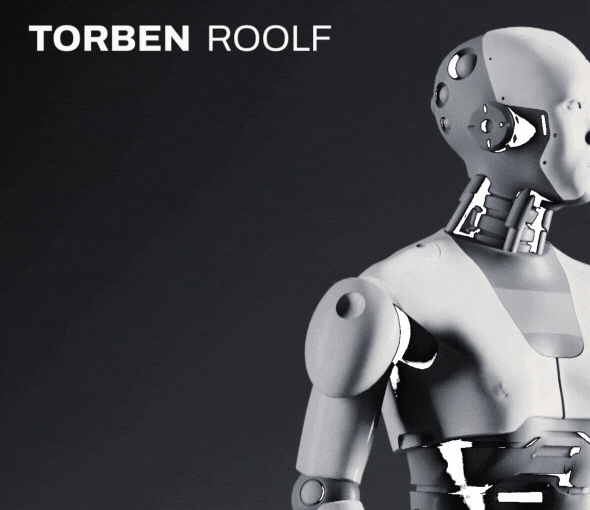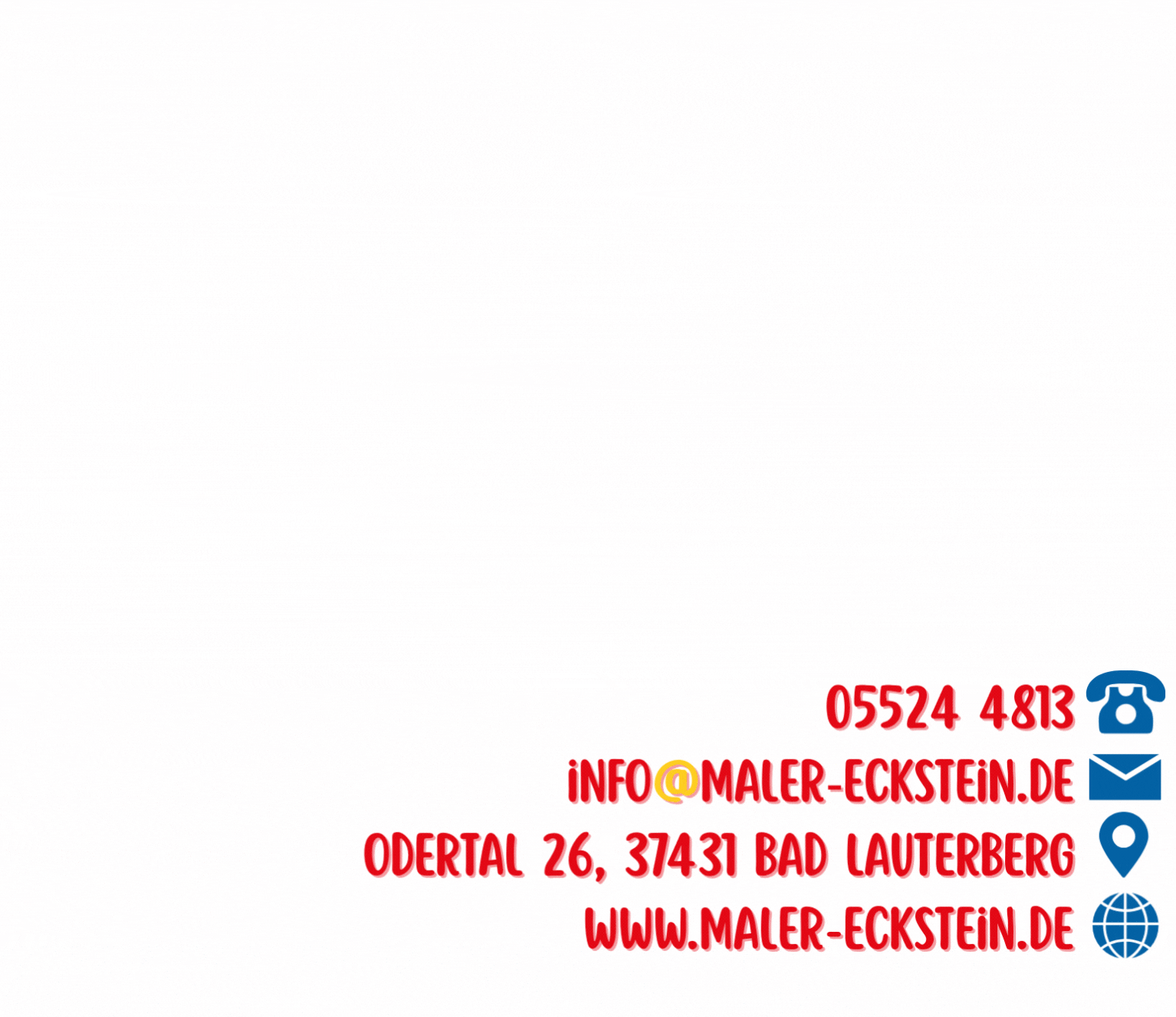Das GutsMuths-Denkmal in Quedlinburg ist mehr als nur eine bronzene Skulptur: Es steht für die Geschichte der deutschen Turnbewegung, die Erziehungsideale der Aufklärung und die lokale Identität der Stadt. Doch wie bei vielen Denkmälern musste auch dieses über die Jahre hinweg Rückschläge und Beschädigungen hinnehmen – und erlebte schließlich eine Rettung, die wichtiger war als nur restauratives Handwerk.
Die Rettung des GutsMuths-Denkmals in Quedlinburg ist ein Beispiel dafür, wie Denkmalpflege weit mehr sein kann als technische Restaurierung: Sie ist ein Ausdruck von Wertschätzung, historischen Bewusstsein und lokalem Engagement. Durch die Wiederherstellung des fehlenden Stocks gewinnt das Denkmal nicht nur seine Vollständigkeit zurück, sondern auch symbolisch an Bedeutung. In einer Zeit, in der kulturelles Erbe vielerorts unter Druck steht, zeigt dieses Projekt, dass es möglich ist, vergessene oder beschädigte Monumente wieder lebendig zu machen – und dass ihre Rettung für die Gemeinschaft einen wirklichen Gewinn darstellt.
GutsMuths gilt als Mitbegründer der Turnbewegung
Johann Christoph Friedrich GutsMuths (1759–1839) gilt als einer der Begründer der modernen Leibeserziehung bzw. des Turnens. Sein Geburtsort ist Quedlinburg, und genau dort befindet sich auch das Denkmal.
Das Denkmal wurde 1904 eingeweiht, geschaffen vom Quedlinburger Bildhauer Richard Anders. Die Plastik zeigt GutsMuths als wandernde Figur, begleitet von seinem Lieblingsschüler Carl Ritter. Das Denkmal steht auf einem hohen Granitsockel, der ursprünglich mit vier Reliefs ausgestattet war, welche Szenen aus dem Leben GutsMuths darstellten.
Denkmal hat bewegte Geschichte hinter sich
Im Laufe des 20. Jahrhunderts erlitt das Denkmal erhebliche Schäden: Die Bronze-Relieftafeln am Sockel – Teil der künstlerischen Ausgestaltung – wurden im Zweiten Weltkrieg eingeschmolzen. Nachdem die Tafeln entfernt waren, blieb das Denkmal unvollständig. Besonders auffällig ist, dass ein wichtiges Detail fehlt: Der Wanderstock, den Carl Ritter in der Originalversion in der Hand hielt, existiert schon seit Jahrzehnten nicht mehr.
Diese Lücke im Denkmal war nicht nur ästhetisch, sondern auch symbolisch bedeutsam: Der Stock war ein Teil der Figurensprache – er signalisierte Bewegung, Führung, Lehre. Seine Abwesenheit verwies damit auch auf eine unterbrochene Erinnerungskultur.
Sanierung stand im Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit
Im Jahr 2025 berichtete die Mitteldeutsche Zeitung, dass ein Wiederaufbau des fehlenden Stocks geplant ist. Dieser Schritt war möglich, weil eine breite Aufmerksamkeit für den Zustand des Denkmals entstand. Bürgerinnen und Bürger, Vereine und vermutlich auch Denkmalfachleute setzten sich für eine Sanierung ein.
Gleichzeitig hatte schon früher eine Restaurierung der Sockelreliefs stattgefunden: Die vier Reliefs wurden neu geschaffen bzw. rekonstruiert. Damit ist das Denkmal in seiner Gesamterscheinung zumindest teilweise wieder näher an die ursprüngliche Gestalt gerückt.
Auch die Stadt Quedlinburg würdigt das Denkmal nach wie vor als Teil ihres kulturellen Erbes. Im Rahmen ihrer städtischen Öffentlichkeitsarbeit wird das Denkmal als Objekt des Monats hervorgehoben, und seine Geschichte, einschließlich der Rettungsmaßnahmen, ist Teil dieses Narrativs.
Die Rettung des Denkmals ist aus mehreren Perspektiven bedeutsam
GutsMuths ist eine historische Persönlichkeit mit überregionaler Bedeutung – insbesondere für den deutschen Sportunterricht. Sein Denkmal in Quedlinburg erinnert daran und verbindet die Stadt mit seiner Lebensleistung.
Dass Quedlinburg nicht nur sein Geburtshaus, sondern auch sein Denkmal bewahrt, stärkt das lokale Geschichtsbewusstsein. Die Initiative zur Wiederherstellung zeigt, dass die Bürger die Bedeutung dieses Denkmals für ihre Stadt erkennen.
Der fehlende Wanderstock war nicht nur ein materielles Defizit, sondern auch ein Symbol für eine unterbrochene Erinnerung. Mit seiner geplanten Wiederherstellung wird ein fehlender Teil des Narrativs wiederhergestellt – es ist eine symbolische Wiederherstellung von Führung, Bewegung und Lehre. Die Rettung zeigt, wie wichtig kontinuierliches Engagement ist. Es ist nicht nur Aufgabe von Denkmalbehörden, sondern auch der Zivilgesellschaft, sich um solche Bauwerke zu kümmern. Der Fall kann als Beispiel dienen für erfolgreiche partizipative Denkmalpflege.