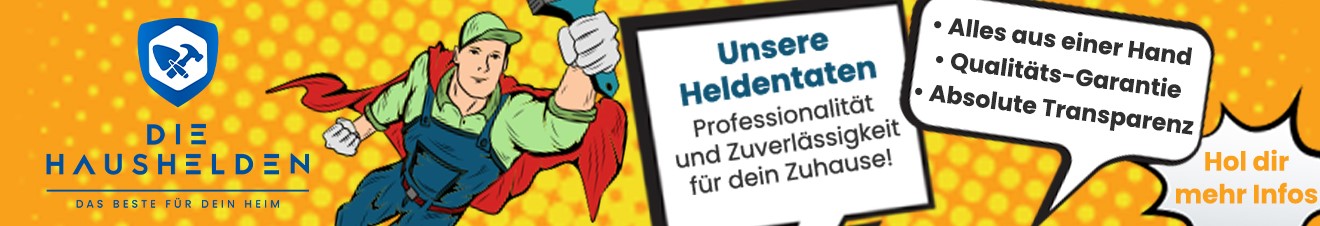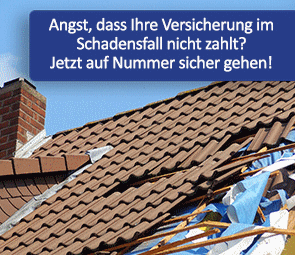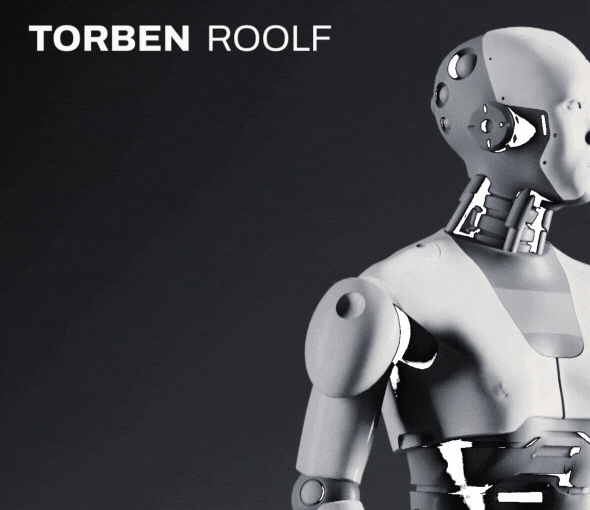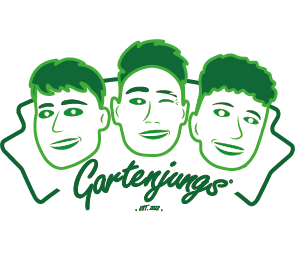Wernigerode (red). Am 21. August 1943 wurden 43 Bewohnerinnen der Einrichtung „Guter Hirte“ von den Nationalsozialisten verschleppt und ermordet. Anlässlich des 82. Jahrestages fand am Mittwoch im Garten des Hauses in der Friedrichstraße eine Feierstunde mit Andacht statt.
Karsten Noack, Mitarbeiter des Guten Hirten, hielt die Ansprache und erinnerte eindringlich an das Geschehen. „Die Frauen wurden nie wiedergesehen. Ein Bus fuhr vor, und die Frauen mussten einsteigen. Sie wurden nicht gefragt, ob sie das wollten. Es wurde ihnen nicht gesagt, wohin sie gebracht werden. Dann, in Bernburg, wurden sie ermordet. Es macht uns betroffen. Das ist schlimm, und ich frage mich: Wie konnte das geschehen? Wie konnten die Menschen – die Mitarbeitenden, die Angehörigen, die Anwohner, all die Menschen in der Stadt und im Land – das zulassen? Wer nimmt für sich in Anspruch, über Leben und Nicht-Leben zu entscheiden? Auch heute urteilen wieder Menschen und sagen: ‚Diese Menschen sind krank, sie sind moralisch schwachsinnig. Sie sind zu teuer für uns. Sie sind eine Last und nicht wert, zu leben.‘“
Im Anschluss an die Ansprache führte Noack die Gäste zum Gedenkstein vor dem Haus. Dort wurden Lieder gesungen, Kerzen entzündet, gebetet und eine Blumenschale niedergelegt.
Hintergrund
Die Einrichtung „Guter Hirte“ wurde Mitte des 19. Jahrhunderts gegründet. Erste Mädchen zogen 1861 in ein Erziehungshaus für geistig behinderte Mädchen in Hasserode ein, 1867 folgte der Umzug an den Standort Friedrichstraße. Im August 1943 beschlagnahmten die Nationalsozialisten das Haus und nutzten es als Kinderheim der Nationalsozialistischen Volkswohlfahrt. 1950 wurde dort eine Anstalt für epileptische Frauen und Mütter eröffnet. Seit 1994 leben erstmals auch Männer im Guten Hirten. Heute wohnen Frauen und Männer mit unterschiedlichen Behinderungen gemeinsam in gemischten Wohngruppen.
Euthanasie im Dritten Reich
Die Nationalsozialisten erklärten Menschen mit körperlichen, geistigen und psychischen Behinderungen für „lebensunwert“. Ab 1939 begann die systematische Tötung im Rahmen der sogenannten „Aktion T4“. Die Opfer wurden in speziellen Anstalten durch Gas, Medikamente oder Nahrungsentzug ermordet. Offiziell wurde die Aktion 1941 beendet, die Verbrechen setzten sich jedoch in dezentraler Form fort. Insgesamt fielen etwa 200.000 Menschen dieser Politik zum Opfer.