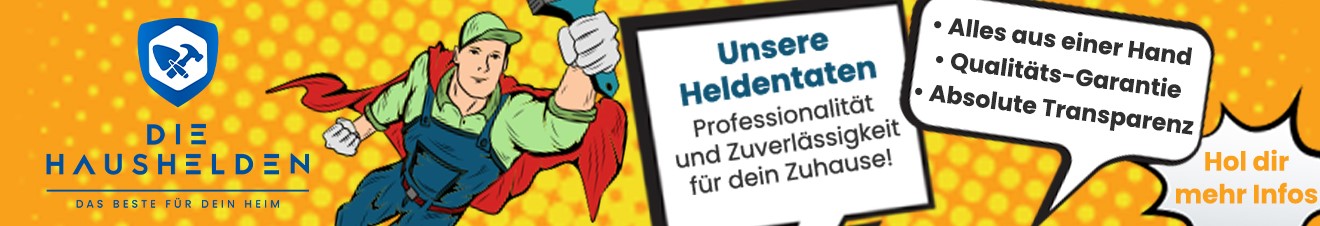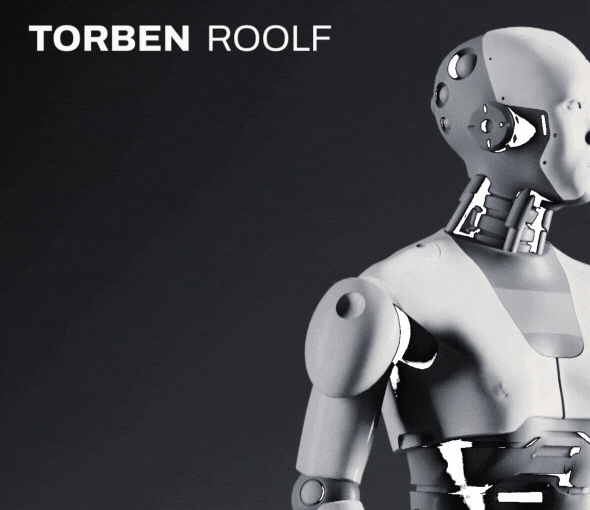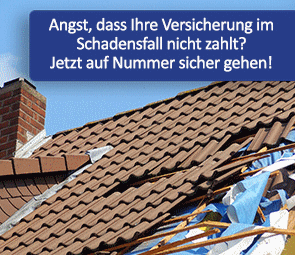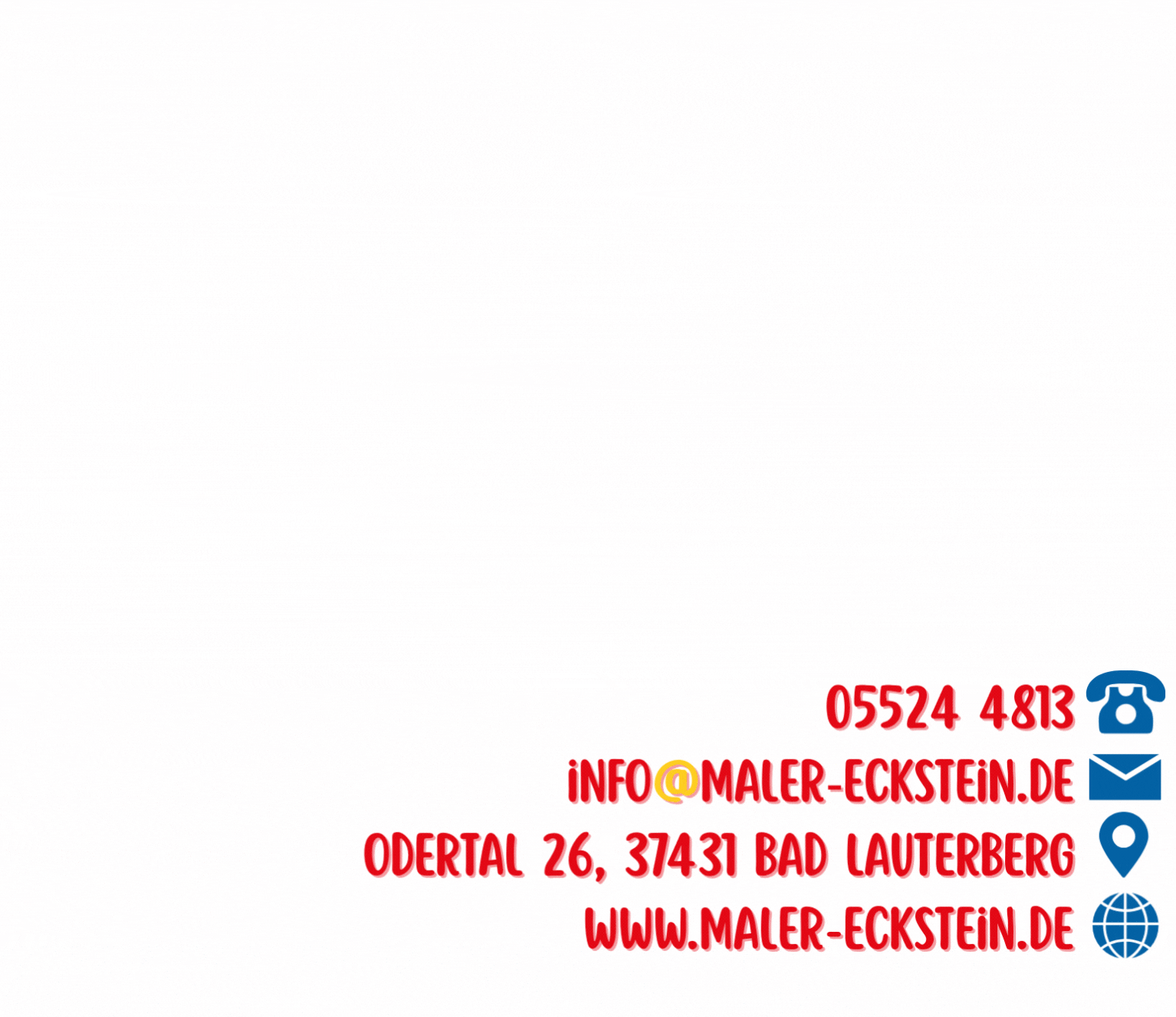Geschichte wird oft durch große Ereignisse erzählt – Kriege, politische Entscheidungen, Umbrüche. Doch wirklich begreifen lässt sie sich erst an den individuellen Schicksalen. Das Leben von Erich Paulicke (1926–2007) ist ein solches Schicksal. Er steht exemplarisch für viele Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung von Menschen mit Behinderungen, deren Stimmen lange ungehört blieben.
Zugleich hat Paulicke durch seine Kunst ein bleibendes Zeugnis hinterlassen, das uns bis heute zum Nachdenken über Menschlichkeit, Erinnerung und Verantwortung zwingt.
Die Anfänge von Erich Paulicke: Kindheit und Verfolgung
Erich Paulicke wurde 1926 in Osterode am Harz geboren. Schon früh galt er als „anders“, als „nicht normgerecht“ – eine Zuschreibung, die im nationalsozialistischen Deutschland fatale Folgen hatte. Unter der NS-Ideologie wurden Menschen mit Behinderungen als „lebensunwertes Leben“ stigmatisiert. Paulicke wurde Opfer dieser menschenverachtenden Politik.
Ab 1939 begann das nationalsozialistische Regime mit systematischen Deportationen aus Anstalten. Auch Paulicke geriet in diesen Strudel. Er kam zunächst in die Rotenburger Anstalten, später, 1943, nach Kaufbeuren-Irsee. Dort war er der sogenannten „E‑Kost“ ausgesetzt – einer Mangelernährung, die oft gezielt eingesetzt wurde, um Menschen langsam zu töten. Mit nur 18 Jahren soll er gerade einmal 36,5 Kilogramm gewogen haben. Ob er zusätzlich medizinischen Experimenten ausgesetzt war, ist nicht vollständig geklärt, doch Indizien deuten darauf hin.
Überleben nach 1945 – Kunst als Sprache des Erinnerns
Paulicke überlebte wie durch ein Wunder die nationalsozialistische Verfolgung. Nach Kriegsende kehrte er in die Rotenburger Anstalten zurück. Dort lebte er bis zu seinem Tod im Jahr 2007. Doch anders als viele andere Betroffene schwieg er nicht über das, was ihm widerfahren war. Er begann, seine Erfahrungen auf eine Weise auszudrücken, die ihn nicht nur selbst entlastete, sondern auch die Öffentlichkeit erreichte: durch Kunst.
In der Bildnerischen Werkstatt der Rotenburger Werke entwickelte Erich Paulicke eine eigene, ausdrucksstarke Bildsprache. Seine Werke, seien es Malereien, Plastiken oder Collagen, sind geprägt von Symbolen, von existenziellen Fragen, von Bildern des Leidens und Überlebens. Titel wie „über leben“ deuten an, dass sein Werk weit über das Persönliche hinausgeht.
Die Kunst wurde für ihn zur Möglichkeit, das Unsagbare sichtbar zu machen. Sie war Erinnerung, Verarbeitung und Kommunikation zugleich. In seinen Arbeiten mischten sich autobiografische Spuren mit universellen Aussagen über Gewalt, Angst, aber auch über Hoffnung und Beharrlichkeit. Seine Werke fanden Eingang in Ausstellungen und machten ihn in künstlerischen Kreisen bekannt.
Er war der letzte Überlebende: Erinnerung und Vermächtnis
Als letzter Überlebender unter den rund 800 Menschen, die aus den Rotenburger Anstalten während des NS-Regimes deportiert worden waren, hatte Paulicke eine besondere Rolle. Er war nicht nur ein Opfer, sondern ein lebendiges Zeugnis. Seine Biografie sensibilisiert dafür, wie sehr die Verfolgung von Menschen mit Behinderungen im öffentlichen Gedächtnis lange verdrängt worden ist. Erst spät fanden seine Geschichte und seine Kunst Anerkennung.
Paulicke starb am 29. März 2007 in Rotenburg. Doch sein Vermächtnis lebt fort – in seinen Kunstwerken, in Ausstellungen, in Gedenkveranstaltungen. Sein Name steht heute nicht nur für ein individuelles Schicksal, sondern auch für das kollektive Erinnern an die Opfer der NS-„Euthanasie“.
Was wir aus der Geschichte von Erich Paulicke lernen können
Das Leben von Erich Paulicke zeigt in bedrückender Deutlichkeit, welche Grausamkeit eine Ideologie entfesseln kann, die Menschen in „lebenswert“ und „lebensunwert“ einteilt. Es zeigt zugleich, dass Überleben mehr sein kann als ein biologisches Faktum: Paulicke überlebte nicht nur, er fand eine Form, seine Erfahrungen zu artikulieren und weiterzugeben.
Damit wird er zum Mahner für die Gegenwart. Seine Kunst ruft uns dazu auf, wachsam zu sein gegenüber Ausgrenzung und Menschenfeindlichkeit – und im scheinbar Schwachen das Menschliche zu erkennen. Erich Paulicke hat uns gelehrt, dass Kunst Erinnerung bewahren und Menschlichkeit verteidigen kann.