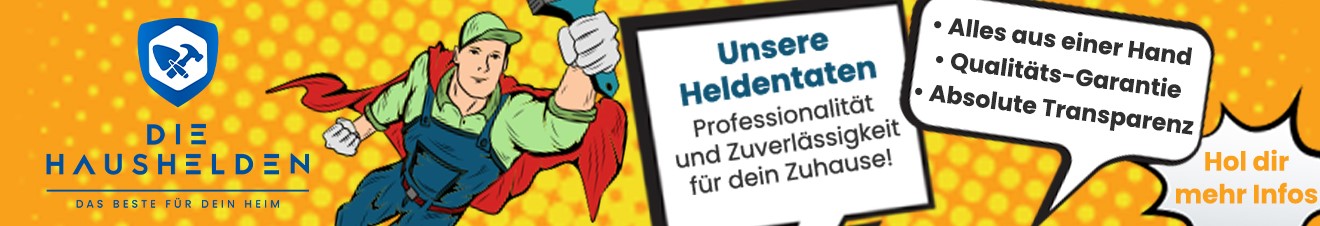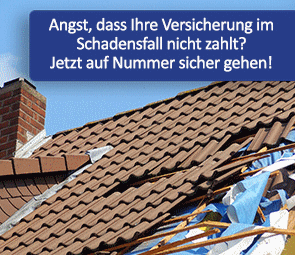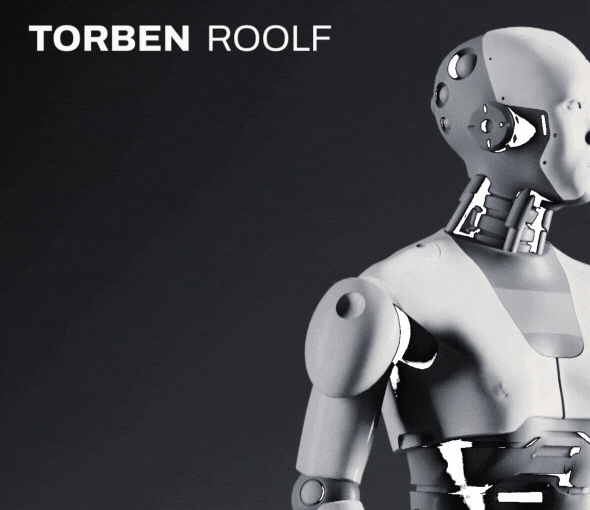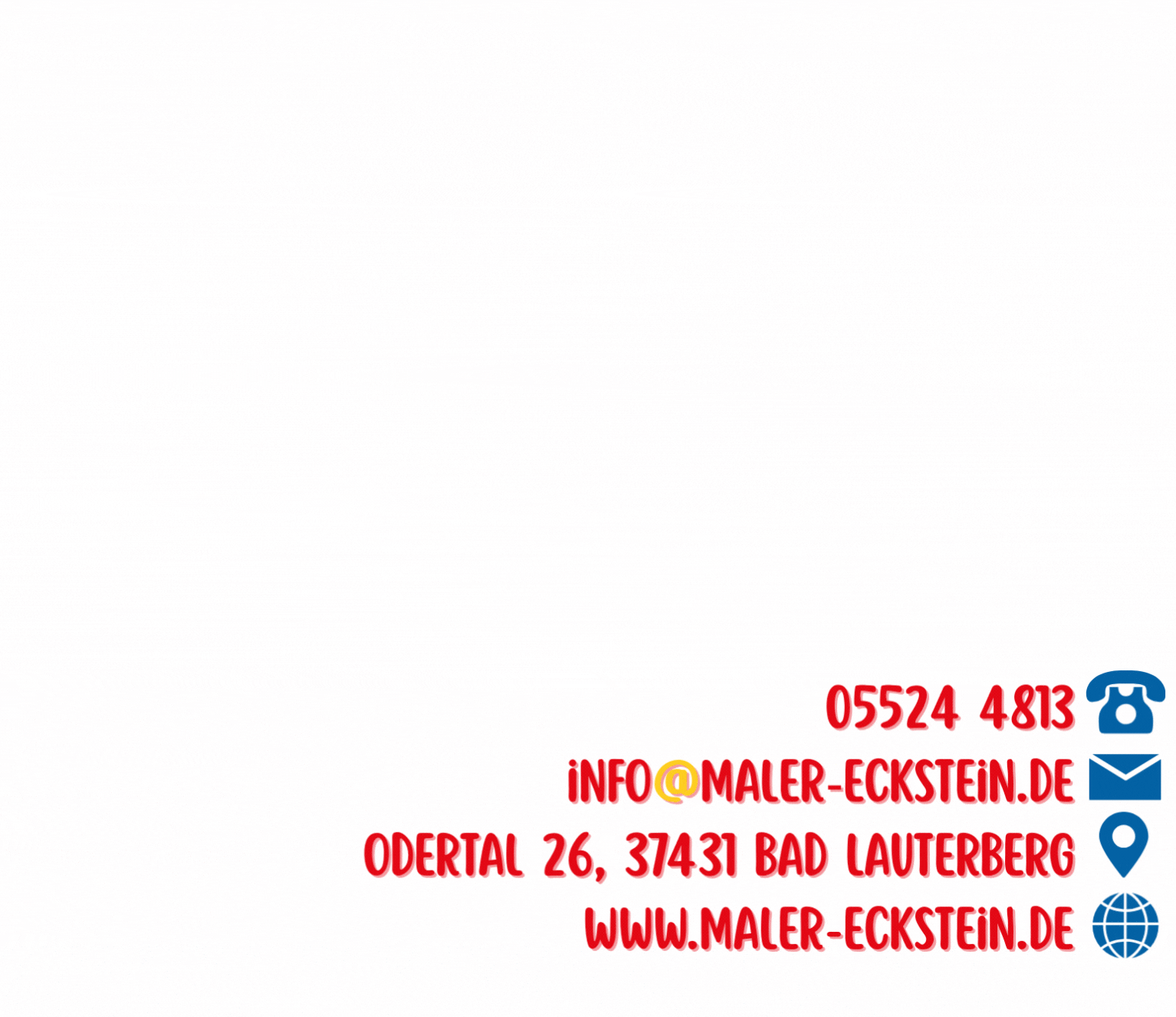Kinderarmut und mangelnde Teilhabe sind nicht nur abstrakte Probleme – sie haben konkrete Auswirkungen auf den Alltag von Kindern, Familien und der ganzen Gesellschaft. Das Projekt „Chancenreich für Kinder in Osterode“ ist ein lokaler Ansatz, der genau hier ansetzt: Es möchte Bedingungen schaffen, damit alle Kinder – unabhängig von ihrer Herkunft oder finanziellen Situation – faire Startmöglichkeiten bekommen.
„Chancenreich für Kinder in Osterode“ ist ein beispielhaftes Projekt, das zeigt, dass kommunales Handeln etwas bewirken kann. Es kombiniert Prävention, Netzwerkkoordination und direkte Unterstützung, um Kinderarmut zu bekämpfen und Chancengleichheit zu fördern. Wichtig ist, dass das Engagement nicht punktuell bleibt, sondern langfristig und breit getragen wird – von der Stadt, von Institutionen und von der Bevölkerung. Wenn dies gelingt, können wir in Osterode (und darüber hinaus) ein Umfeld schaffen, in dem alle Kinder das Recht haben, sich zu entfalten und stark zu werden.
Soziale Ungleichheiten auf lokaler Ebene verringern
Das Projekt wird von der Stadt Osterode am Harz gemeinsam mit dem Landkreis Göttingen und dem DRK-Familienzentrum getragen. Es ist Teil des Landesprogramms „Chancengleich in der Nachbarschaft“, das darauf abzielt, soziale und wirtschaftliche Ungleichheiten auf lokaler Ebene zu verringern.
Kinderarmut ist in Osterode wie anderswo eine Realität, die nicht ignoriert werden darf. Armut kann dazu führen, dass Kinder weniger Zugang zu Bildungsangeboten, Gesundheitsvorsorge, Freizeitaktivitäten oder sozialen Kontakten haben. Das Projekt will hier vorbeugen und Hilfe möglichst früh, gezielt und unbürokratisch anbieten.
Die Mission: Mit konkreten Zielen Familien in Armut unter die Arme greifen
1. Erreichbarkeit armutsbetroffener Kinder und Familien verbessern.
2. Aufbau einer nachhaltigen und zielgruppengerechten Kommunikations- und Vernetzungsstruktur. Dafür sollen Fachkräfte aus Jugendhilfe, Gesundheitswesen, Jobcenter etc. besser zusammenarbeiten.
3. Förderung der sozialen Teilhabe durch Bildungsangebote, Gesundheitsförderung, Freizeit, Integration.
Initiatoren haben konkretes Maßnahmenpaket
· Netzwerkbildung Verschiedene Stellen – Jugendhilfe, Jobcenter, Gesundheitsamt, Polizei, Vereine, das DRK-Familienzentrum und andere – arbeiten gemeinschaftlich. So wird sichergestellt, dass Hilfe dort ankommt, wo sie gebraucht wird, und dass Ressourcen nicht doppelt vergeben werden.
· Niedrigschwellige Angebote Hilfe ohne große bürokratische Hürden ist ein zentraler Aspekt. Familien sollen schnell und unkompliziert Unterstützung bekommen. Das kann heißen: Hilfen im Alltag, Zugänge zu Freizeitangeboten, Bildungsförderung oder Gesundheitsvorsorge.
· Kooperation mit Familienzentren Das DRK-Familienzentrum ist ein zentraler Partner. Es fungiert als Anlaufstelle, Beratungsort und Vermittler von Angeboten, die für Familien wichtig sind.
Kinder, die sonst vielleicht zurückstehen, bekommen bessere Chancen in Bildung, Gesundheit und sozialen Beziehungen. Das stärkt ihr Selbstwertgefühl und ihre Perspektiven. Familien werden entlastet – etwa durch Beratungsangebote, Angebote zur Freizeitgestaltung, aber auch durch bessere Verbindungen zu Unterstützungsstrukturen. Das kann finanzielle, psychische oder organisatorische Lasten verringern.
Schwer erreichbare Familien brauchen oftmals am meisten Hilfe
Wenn mehr Kinder aktiv am gesellschaftlichen Leben teilhaben können, profitieren alle: Schulen, soziales Miteinander, Ehrenamt, Nachbarschaften. Ein Netzwerk aus Institutionen und Menschen stärkt den Zusammenhalt. Damit das Projekt dauerhaft wirkt, braucht es nachhaltige Finanzierung, beständige Strukturen und eine dauerhafte Verankerung in kommunalen Institutionen.
Die schwer erreichbaren Familien oder Kinder sind oft genau diejenigen, die am meisten Hilfe brauchen. Es braucht Vertrauen, Zugänge, Sprache, kulturelle Sensibilität, und oft auch Mobilität oder digitale Teilhabe. Wie kann man feststellen, ob die Maßnahmen wirklich Wirkung zeigen? Es braucht Indikatoren wie bspw. wie viele Kinder Zugang zu Angeboten bekommen, wie sich ihre Leistungen, Gesundheit oder soziale Teilhabe entwickeln. Manche Angebote sind vielleicht räumlich oder zeitlich begrenzt. Damit möglichst viele profitieren, müssen sie ausgeweitet, vervielfältigt oder angepasst werden.