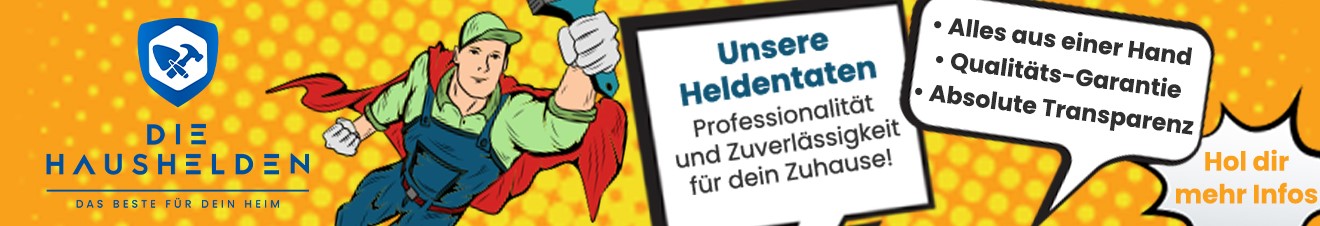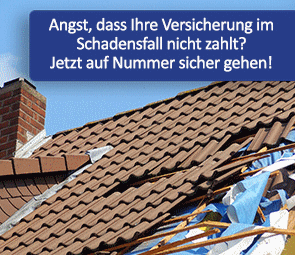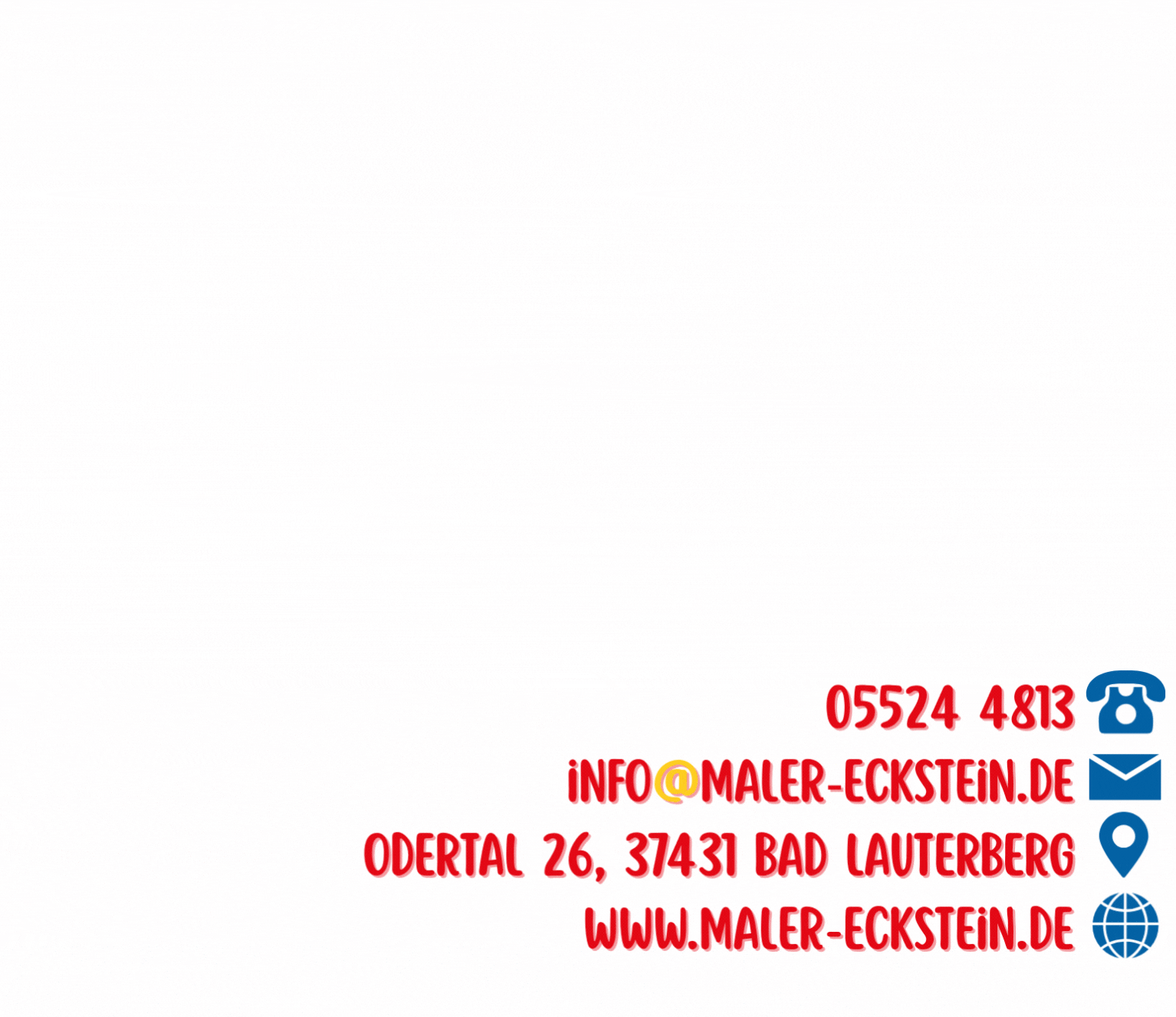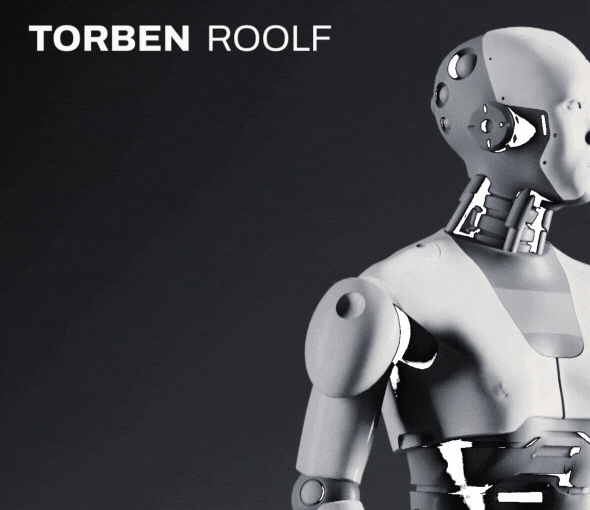Im Harz gibt es nicht nur zauberhafte Wanderwege, die der Seele Erholung verschaffen. Auch eine große Anzahl von wunderschönen Burgen, Ruinen und Schlössern sind einen Besuch wert. Um sie ranken sich teils mystische Geschichten und erzählen von der deutschen Vergangenheit. Wir haben für Sie eine Auswahl an diesen architektonischen Kunstwerken zusammengestellt, um Ihnen die Entscheidung zu erleichtern.
In vergangene Jahrhunderte zurückversetzt: Von Schlachten und Getümmeln
“Ein’ feste Burg ist unser Gott,” heißt es in einem alten Kirchenlied von Martin Luther. Nicht weniger als 20.000 Burgen gab es hierzulande während des Mittelalters. Im 14. Jahrhundert ist die große Zeit des Burgenbaus allerdings vorbei. Vorhandene Anlagen werden nur erweitert oder umgebaut. Doch die Erfindung des Schießpulvers hat für die Burgen fatale Folgen. Schon Anfang des 14. Jahrhunderts kommen erste Pulvergeschütze zum Einsatz. Mit der technischen Weiterentwicklung zu Kanonen, die weite Entfernungen überbrücken können, wird die Verteidigung einer Burg nahezu unmöglich. Der Angreifer kann in sicherer Entfernung abwarten, bis die Burg zerstört ist.
Durch die Erfindung der Feuerwaffen stirbt auch der Berufsstand der Ritter aus. Die Schlachten werden nicht mehr in Nahkämpfen Mann gegen Mann entschieden, sondern aus größerer Entfernung geführt. Die Heere stellen auf Söldner um.
1. Schloss Wernigerode
Das Schloss Wernigerode gehört ohne Zweifel zu den spannendsten Burgen und Schlössern im Harz., Es ist auch als das Neuschwanstein des Nordens bekannt und hat eine interessante Geschichte. Es wurde ursprünglich als mittelalterliche Burg im 12. Jahrhundert über der Stadt errichtet. Späterdiente es den deutschen Kaisern während ihrer Jagdausflüge in die umliegenden Wälder. Im 15. Jahrhundert wurde es im Stil der Spätgotik stark erweitert, wodurch im 16. Jahrhundert eine Renaissancefestung entstand. Allerdings wurde das Schloss im Dreißigjährigen Krieg massiv beschädigt.
Graf Ernst zu Stolberg-Wernigerode begann im 17. Jahrhundert mit dem Umbau zu einem barocken und romantischen Residenzschloss.
Anschließend, unter der Leitung von Architekt Carl Frühling und Graf Otto zu Stolberg-Wernigerode, einem Vizekanzler von Otto von Bismarck, wurde es zum Symbol des norddeutschen Historismus umgestaltet.
1929 wurde das Schloss als Wohnsitz aufgegeben wurde. Seitdem ist das Bauwerk für die Öffentlichkeit zugänglich. Heute gehört es zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten im Harz.
2. Schloss Harzgerode
Eingebettet im Harz steht das Schloss Harzgerode in Sachsen-Anhalt. Es zeichnet sich durch eine besonders bedeutungsvolle Historie aus. Ursprünglich diente es als Residenz für die Adeligen einer Anhalt-Bernburg-Harzgeroder Nebenlinie. Das Schloss liegt am Nordwestrand der historischen Altstadt, und geht auf die Anfänge des 13. Jahrhunderts zurück. 1384 erstmals urkundlich erwähnt, wurde es als Zwingburg der anhaltinischen Fürsten errichtet. Von 1398 bis 1535 handelten hauptsächlich die Grafen von Stolberg als Lehnsherren, später wurde Harzgerode zum Verwaltungszentrum der Fürsten von Anhalt.
In der Zeit zwischen 1549 und 1552 gestaltete Fürst Georg III. von Anhalt das Schloss neu. Von 1635 bis 1709 diente es als Residenz für die Harzgeroder Linie der Fürsten von Anhalt. Dies spiegelt sich auch in der Namensgebung von Straßen und Institutionen in Harzgerode wider. Beispiele hierfür sind die Augustenstraße und die Försterei Wilhelmshof sowie die nach den Adeligen benannte Grube “Albertine”.
Besucher des öffentlich zugänglichen Schlosses Harzgerode können zahlreiche Zeugnisse aus vergangenen Epochen zu entdecken. Beeindruckend ist der Festsaal mit einem Parkett aus 18 verschiedenen Holzarten.
3. Schloss Blankenburg
Das Schloss Blankenburg im Harz gilt als das größte noch erhaltene Welfenschloss. Es kann auf eine beeindruckende 900-jährige Geschichte zurückblicken und ist das stolze Wahrzeichen der Stadt Blankenburg. Das Schloss steht auf dem Blankenstein, einer schwer einnehmbaren Bergkuppe, die bereits 1123 mit einer Burg im Zusammenhang mit Kaiser Lothar III. urkundlich erwähnt wurde. Anfänglich gebaut aus Bauwerken der Renaissance und mittelalterlichen Burgresten, bekam der barocke Schlossbau im 18. Jahrhundert seine heutige Form.
Nach das Schloss durch König Barbarossa im Jahr 1182 zerstört worden war – und zahlreiche Besitzwechsel später – erfolgte im 16. Jahrhundert der Renaissance-Stil-Aufbau. Die Grafschaft fiel danach an das Herzogtum Braunschweig-Lüneburg, und das Schloss fungierte im 17. Jahrhundert als Jagdschloss sowie im 18. Jahrhundert als Barockresidenz Kulturzentrum im Harz.
1714 wurde die Grafschaft durch ein Edikt Kaiser Josephs I. zum Fürstentum. 1731 jedoch verließen die Schlossherren das Anwesen und gaben es dem Verfall preis, bis es im 19. Jahrhundert restauriert wurde. Im 20. Jahrhundert waren die Herzöge von Braunschweig die Besitzer des Schlosses. 1945 wurden sie enteignet und das Schloss zum Volkseigentum erklärt. Heute widmet sich der Verein zur Rettung des Schlosses Blankenburg der Wiederinstandsetzung. Er hatte das Anwesen im Jahr 2008 erworben.
Zwar sind einige Bereiche aufgrund umfangreicher Sanierungsarbeiten für die Öffentlichkeit geschlossen. Allerdings können Besucher ausgewählte Bereiche erkunden, darunter das Theater, der Graue Saal, der Kaiser- und Rittersaal sowie die Schlosskapelle. Frei zugänglich ist auch der Schlossinnengarten.
4. Burg Falkenstein
Unter allen Burgen im Harz ist die Burg Falkenstein eine der imposantesten. Dieses Bauwerk ist relativ gut erhalten und stammt aus der Zeit des Hochmittelalters zwischen 1120 und 1180. Östlich von Gernrode und Thale gelegen, erhebt sie sich auf einem Felsrücken in etwa 320 Metern Höhe über der Thalmühle, wo sie von den dichten Wäldern des Naturschutzgebiets Selketal umgeben ist. Um die Burg rankt sich eine Legende. Ihr zufolge soll ihr Ursprung auf einen Mord zurückgehen. Angeblich wurde Graf Adalbert II. von Ballenstedt um 1080 während eines Streits durch Egenos II. von Konradsburg getötet. Als Vergeltung wurde der Stammsitz von Egeno in ein Kloster umgewandelt. Burchard von Konradsburg, der Sohn von Egenos II., errichtete die Burg Falkenstein als neuen Stammsitz im Harz.
Die eindrucksvolle Höhenburg erstreckt sich über etwa 90 mal 310 Meter und besteht aus einer sogenannten Kernburg sowie aus drei rund 40 mal 40 Meter großen Vorburgen sowie einer Tor- und Zwingeranlage. Der Bergfried, mit einer Höhe von etwa 31 Metern, besteht aus Mauern von rund zwei Metern Dicke und einem Durchmesser von etwa 8,5 Metern. Vom Bergfried aus bietet sich ein zauberhafter Blick auf das Selketal, und eine 20 Meter tiefe Zisterne, die ebenfalls zur Burganlage gehört. Heute zählt sie zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten im Harz, erreichbar über einen etwa zwei Kilometer langen Wanderweg.
Die Burg Falkenstein hat als Kulisse für rund 30 Film- und Fernsehproduktionen gedient, darunter verschiedene Märchenfilme und DDR-Kinderserien. Vor Ort werden Führungen angeboten und eine Dauerausstellung über das Mittelalter begeistert die Besucher.
Darüber hinaus beherbergt die Burg eine Falknerei, die mit verschiedenen Flugvorführungen, darunter Falken, Adler und Uhus, das Publikum in Staunen versetzt. Weit über den Harz hinaus bekannt sind regelmäßige Veranstaltungen wie das Minneturnier im Sommer und das Burgfest im Oktober. Die urigen Ritteressen in der rustikalen Atmosphäre der Burggaststätte bieten zudem ein besonderes Erlebnis.
5. Burgruine Regenstein
Die Burgruine Regenstein bei Blankenburg war einst eine stattliche Festung. Ihre Überreste scheinen sich regelrecht mit dem Felsen zu verschmelzen. Lediglich der Bergfried und die in den Felsen geschlagenen Räume sind als Fragmente erhalten geblieben. Bis ins Jahr 1162 reicht ihre Geschichte zurück. Zu dieser Zeit wurde sie erstmals in Verbindung mit Graf Konrad von Regenstein erwähnt. Berühmtheit erlangte die Burg in den 1330er Jahren durch Konflikte mit anderen Herrschenden. Damals stand sie unter der Herrschaft von Albrecht II. von Regenstein. Dieses Thema wurdespäter in der Ballade “Der Raubgraf” von Gottfried August Bürger und dem gleichnamigen Roman von Julius Wolff verarbeitet.
Im 15. Jahrhundert zogen die Regensteiner auf das Blankenburger Schloss um, und die Burg begann zu verfallen. Im Jahr 1599 starb der letzte männliche Nachfahre des Regensteiner Grafengeschlechts. Die Burg sah verschiedene Besitzerwechsel, und 1643 erhielt sie der Graf Wilhelm von Tattenbach als Lehen. Die Preußen bauten 1671 die Burg zur Festung aus und unternahmen umfangreiche Umbauten. In den Jahren danach fanden weitere Erweiterungen statt. Die Franzosen eroberten und zerstörten die Burg Regenstein 1757, nachdem sie sie zuvor übernommen hatten.
Heute sind nur noch die Felseinbauten, das Eingangstor und die Kasematten erhalten. Besonders sehenswert sind die höhlenartigen, in den Fels gehauenen Räume. Sie beherbergen eine Ausstellung mit Bodenfunden aus dem Bereich der Burg. Ein eindrucksvoller Brunnen der aus dem Jahr 1671 datiert und mehr als 197 Meter tief ist, gehört zu den tiefsten Burgbrunnen weltweit. Um drohendes Mauerwerkversagen zu verhindern, wurde der Brunnen im Jahr 1885 zugeschüttet.
Die Legende nach soll eine der hübschesten Jungfrauen einst im Burgverlies gefangen gehalten worden sein, weil sie sich dem Grafen von Regenstein verweigerte. Mit einem Diamantring kratzte sie einen Spalt ins Felsgestein. Nach einem Jahr war dieser groß genug, dass sie hindurchpasste und fliehen konnte. Bei ihrer Rückkehr zur Burg stand der Graf im Fegefeuer. Sie warf sie ihm den Ring zu um ihn zu erlösen,.
Die Ruine Regenstein ist eine oft besuchte Sehenswürdigkeit im Harz. Jährlich werden dort Garnisons- und Ritterspiele veranstaltet.