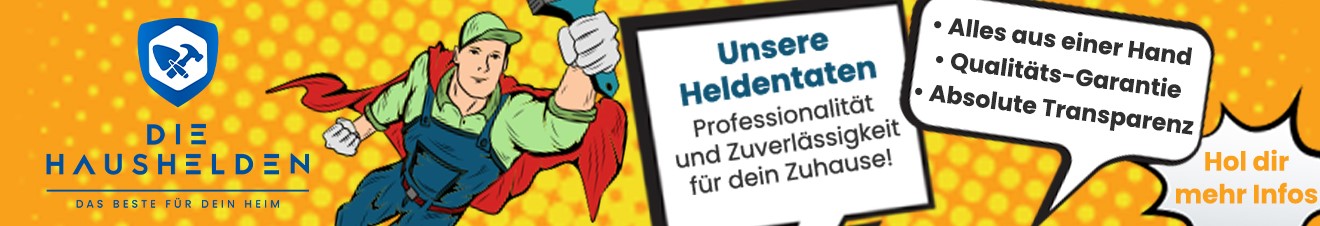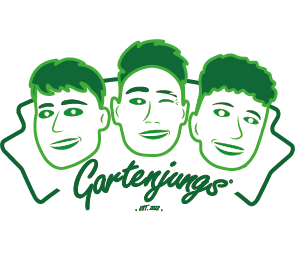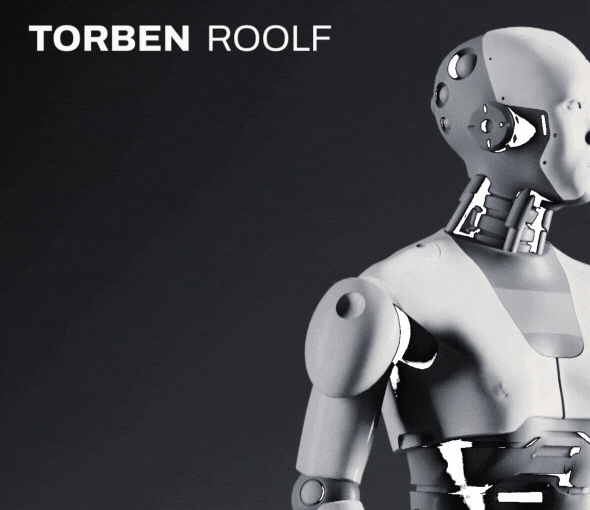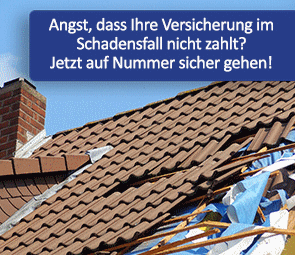Die Harzer Schmalspurbahnen (HSB) stehen an einem Wendepunkt: Sie sind eine der ältesten Schmalspurbahnstrecken Deutschlands und zugleich ein begehrtes Ausflugsziel und Kulturgut. Sie verlaufen über rund 140 Kilometer durch den Harz, zwischen Sachsen-Anhalt und Thüringen. Vor allem durch die Brockenbahn und die Harzquerbahn etc. besitzt sie nicht nur nostalgischen, sondern auch touristischen Wert. In jüngerer Vergangenheit wurde die Frage aufgeworfen, ob die HSB sich um den Status als UNESCO-Welterbe bewerben sollten. Diese Idee wird politisch diskutiert – insbesondere in Sachsen-Anhalt.
Mit der Möglichkeit eines UNESCO-Welterbes könnte ihre Zukunft gesichert werden, ihre Strahlkraft erhöht und ihr kultureller Wert gewürdigt werden. Doch dazu bedarf es mehr als bloßer Symbolik – es braucht konkrete Maßnahmen, klare Konzepte und verlässliche Finanzierung. Wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, dann könnte der UNESCO-Status nicht nur eine Ehrung sein, sondern ein wirksames Mittel, um das Überleben dieses kostbaren technischen Erbes zu sichern.
HSB: Touristenmagnet mit wirtschaftlichen Herausforderungen
Die HSB gelten als technisches Denkmal mit überregionaler Bedeutung und bieten ein zusammenhängendes Schmalspurnetz von ungefähr 140 km. Ein Antrag im Landtag von Sachsen-Anhalt fordert, dass die HSB sich als UNESCO-Weltkulturerbe bewirbt.
Gleichzeitig steht das Unternehmen vor erheblichen Herausforderungen: ein Gutachten bescheinigt einen Finanzbedarf von ca. 800 Millionen Euro bis zum Jahr 2045, um Betrieb, Wartung und Infrastruktur zu sichern. Weitere Probleme sind unter anderem Alters- und Erhaltungszustand von Fahrzeugen und Gleisanlagen, steigende Energiekosten, Personalaufwand, wetterbedingte Beeinträchtigungen insbesondere auf der Brockenstrecke.
Für den Status als Welterbe gibt es viele Argumente
Die HSB sind nicht nur technisches Kulturgut, sondern auch Symbol einer über hundertjährigen Eisenbahntradition im Harz. Sie verbinden Menschen, Landschaft und Technik auf besondere Weise. Ein Welterbe-Status würde Aufmerksamkeit bringen, mehr Besucher anziehen und das Profil der Region stärken. Das könnte touristische Einnahmen erhöhen, was wiederum zur Erhaltung beitragen kann.
Durch den Prestigestatus kämen zusätzliche Schutzmaßnahmen, Fördermittel oder internationale Anerkennung ins Spiel, die helfen könnten, die Bahn nachhaltig zu sichern und zu modernisieren. Für die Menschen vor Ort hat die Bahn Bedeutung über den reinen Transport hinaus: Als Teil der regionalen Identität, als Erinnerung an industrielle und verkehrstechnische Entwicklung.
Der Weg zum Welterbe ist steinig und hat große Hürden
Der riesige Finanzbedarf stellt eine große Hürde dar. Die Frage ist, ob allein durch Welterbe-Status ausreichend Mittel generiert werden können, oder ob Staat, Länder und eventuell EU stark in die Pflicht genommen werden müssten. Einige Teile des Netzes sind in schlechtem Zustand, in manchen Abschnitten sind Strecken gesperrt oder stark reparaturbedürftig. Es stellt sich die Frage, ob der technische Zustand schon den Kriterien entspricht, die UNESCO an Integrität und Authentizität stellt.
Es genügt nicht, dass historische Fahrzeuge und Gleise existieren, sie müssen auch funktionsfähig sein, sicher und wirtschaftlich tragfähig betrieben werden. Auch Umweltaspekte (z. B. Kohlendioxid, Energieverbrauch, Evakuierung bei Wetterlagen) gewinnen zunehmend Bedeutung. Eine Bewerbung und dann ggf. der laufende Status bringen administrativen Aufwand mit sich, Vorgaben und Auflagen, die zusätzliche Last sein könnten.
UNESCO stellt erhebliche Anforderungen an Welterbestätten:
· Ausnahmewert (Outstanding Universal Value): Das Objekt muss in seiner Art einmalig oder exemplarisch sein, überregionale, idealerweise globale Bedeutung besitzen.
· Integrität und Authentizität: Der originale Charakter und die Unversehrtheit müssen weitgehend erhalten sein, Veränderungen müssen dokumentiert und akzeptabel sein.
· Schutz und Management: Es muss sichergestellt sein, dass dauerhafter Schutz, Pflege und Management gewährleistet sind – rechtlich, finanziell und organisatorisch.
· Einbindung in die Region und nachhaltige Entwicklung: Die Welterbestätte sollte im Einklang mit der Umgebung stehen, nicht isoliert, und zum Wohlergehen der lokalen Bevölkerung beitragen.