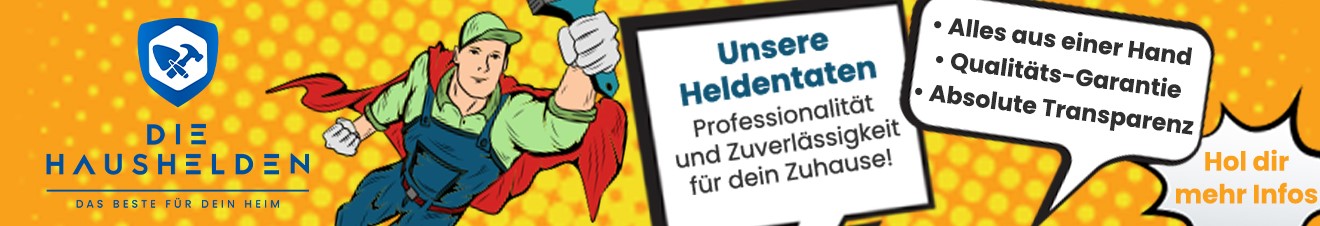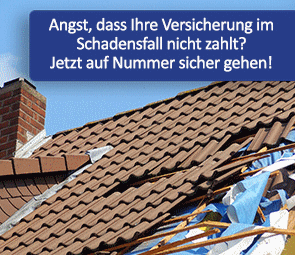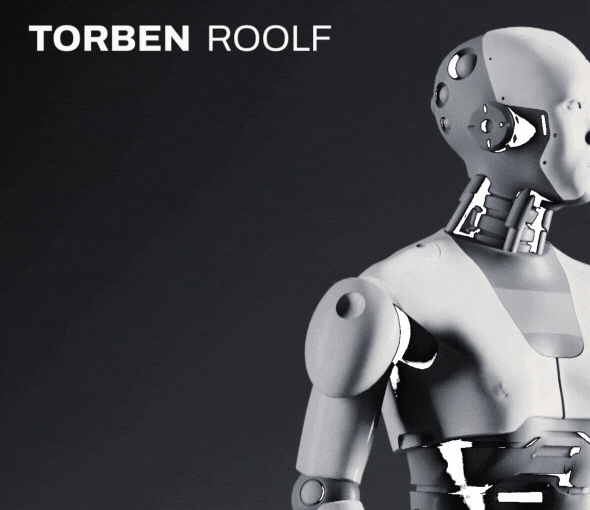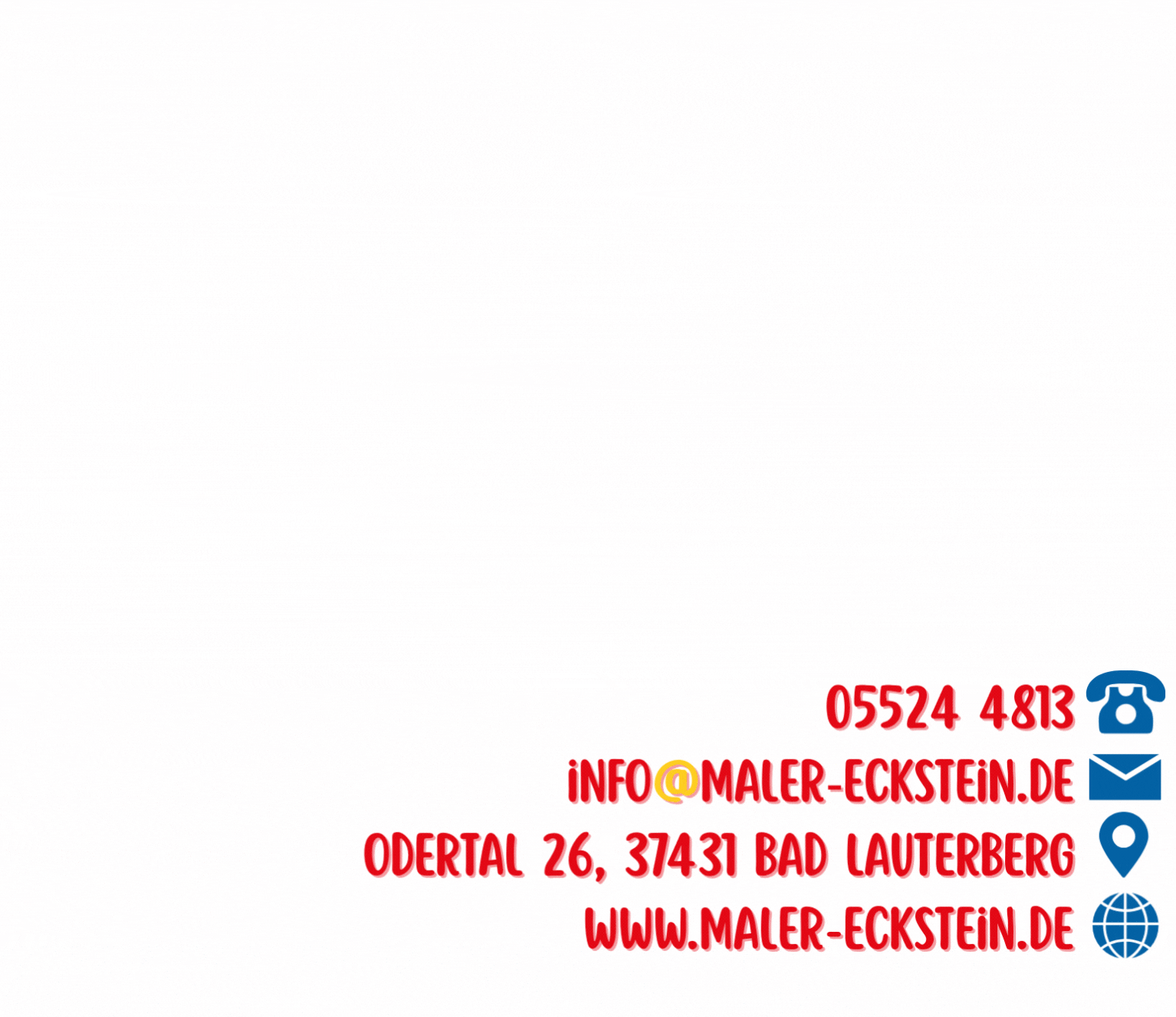Die unterirdische Apotheke bei Blankenburg im Harz ist kein gewöhnliches Lager oder Depot. Sie verbindet Geschichte, Technik, Sicherheit und logistische Herausforderungen auf einmalige Weise. Offiziell Teil des Versorgungs- und Instandsetzungszentrums Sanitätsmaterial der Bundeswehr, wird dieser Komplex oft als die größte unterirdische Apotheke der Welt bezeichnet.
Die „größte unterirdische Apotheke der Welt“ ist weit mehr als ein Lagerort für Medikamente. Sie ist ein Ort, an dem Geschichte, Technik, militärische Strategie und gesundheitliche Versorgungslogistik zusammentreffen. Ihre Existenz zeigt, wie in Deutschland nach Kriegsende und während des Kalten Kriegs Sicherheits- und Versorgungsarchitekturen entstanden sind, die bis heute funktionstüchtig und relevant sind. Gleichzeitig wirft sie Fragen auf — über Verantwortlichkeit, Transparenz und über die Rolle militärischer Einrichtungen in einer demokratischen Gesellschaft.
Nationalsozialisten planten den Komplex für Bau von Kriegsgerät
Die Anlage liegt im Felsmassiv „Regenstein“, nördlich von Blankenburg. Ursprünglich Teil der NS-Pläne gegen Ende des Zweiten Weltkriegs: Der Komplex wurde unter dem Tarnnamen „Turmalin“ geplant als unterirdische Fertigungsfabrik besonders kriegswichtiger Geräte, wie zum Beispiel Teile für U‑Boote und Raketen.
Der Bau erfolgte unter Einsatz von Zwangsarbeitern. Viele Gänge und Stollen wurden in den Sandstein getrieben, um Schutz vor Luftangriffen und Bombardements zu bieten. Nach dem Krieg wechselte die Nutzung: erst als Lager für Lebensmittel oder Champignons, dann in den 1970er Jahren durch die NVA (Nationale Volksarmee der DDR) als Material- und Munitionslager ausgebaut.
Nach der Wiedervereinigung 1990 übernahm die Bundeswehr die Anlage und baute sie zum heutigen Sanitätsmateriallager mit integrierter Pharmabereich („Bundeswehr-Apotheke“) aus.
Apotheke liegt in weit verzweigtem Stollensystem
Das Stollensystem erstreckt sich über eine Länge von etwa acht Kilometern. Die Gesamtfläche unter Tage beträgt etwa 33.000 Quadratmeter; über Tage sind es noch mehr. Es werden etwa 3.000 verschiedene Arzneimittel und medizinische Produkte gelagert. Neben Medikamenten lagert die Anlage auch große Mengen sanitätsdienstlichen Materials wie Verbandszeug, Defibrillatoren, Beatmungs- und Röntgengeräte.
Die Bundeswehr beliefert von hier aus ihre Standorte mit Sanitätsmaterial und Medikamenten. Es handelt sich also um ein strategisches Depot.
In besonderen Situationen, etwa bei Katastrophen oder Kriseneinsätzen, kann das Lager auch eine zentrale Rolle in der Versorgung übernehmen. Es gibt ein eigenes Labor, in dem spezielle Medikamente hergestellt werden — nicht nur einfache Arzneimittel, sondern auch individualisierte und situativ notwendige Produkte.
Der Eingang wird durch ein Tor gesichert, das stark und massiv ist, hydraulisch betrieben. Das Gewicht und die Konstruktion dienen dem Panzerschutz. Die Anlage liegt unter Tage und schützt so gegen äußere Einflüsse wie Luftangriffe, Bomben, extreme Wetterlagen oder auch Temperaturschwankungen.
Interne Klima- und Luftversorgung sind geregelt: konstante Temperatur, geringe Luftfeuchtigkeit und Versorgung mit Frischluft sind gewährleistet.
Anlage ist strategisch und historisch von großer Bedeutung
· Militärisch-strategisch: Mit seiner Lage, Ausstattung und Größe ist die unterirdische Apotheke ein entscheidendes Sanitätsdepot für die Bundeswehr, insbesondere für Auslandseinsätze oder Katastrophenfälle.
· Historisch: Sie ist ein Zeugnis deutscher Geschichte — von nationalsozialistischen Rüstungsplänen, der DDR-Zeit mit Geheimhaltung und Militärlagerung bis in die heutige demokratische Bundeswehr. Damit reflektiert sie Wandlungen deutscher Politik, Militärstruktur und Sicherheitspolitik.
· Ökonomisch/regionale Bedeutung: Der Standort schafft Arbeitsplätze, auch wenn viele Arbeiter in Uniform sind, und generiert infrastrukturelle sowie logistische Anforderungen, die lokale Wirtschaft betreffen. Besucher-Tage zeigen, dass auch zivilgesellschaftliches Interesse groß ist.
Unterirdische Bundeswehr-Apotheke: Viele Herausforderungen und Kontroversen
Der Bau zur NS-Zeit mit Zwangsarbeit wirft ethische Fragen und Verantwortlichkeiten auf; viele Menschen litten oder starben beim Stollenbau.
Geheimhaltung und Militärstatus führen zu Verschwörungstheorien und Gerüchten. Einige Einwohner berichten von Mythen rund um unterirdische Straßen, Herstellung von Raketenteilen etc. Kosten für Betrieb, Wartung, Sicherheit sind beträchtlich. Herstellung eigener Medikamente, Lagerung unter hohen Sicherheitsverhältnissen etc., all das erfordert Aufwand und Ressourcen.