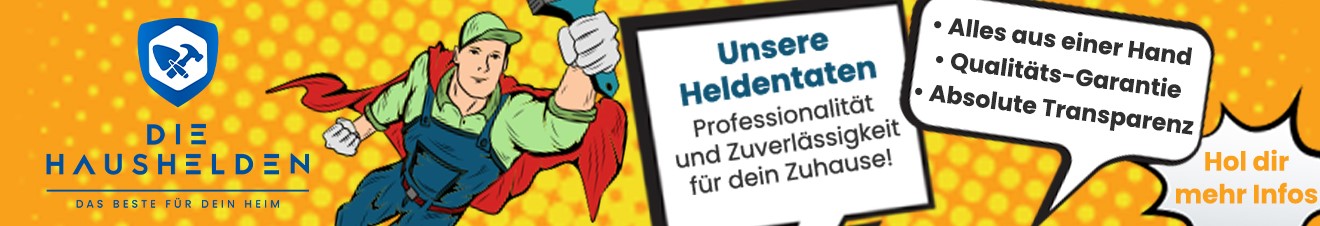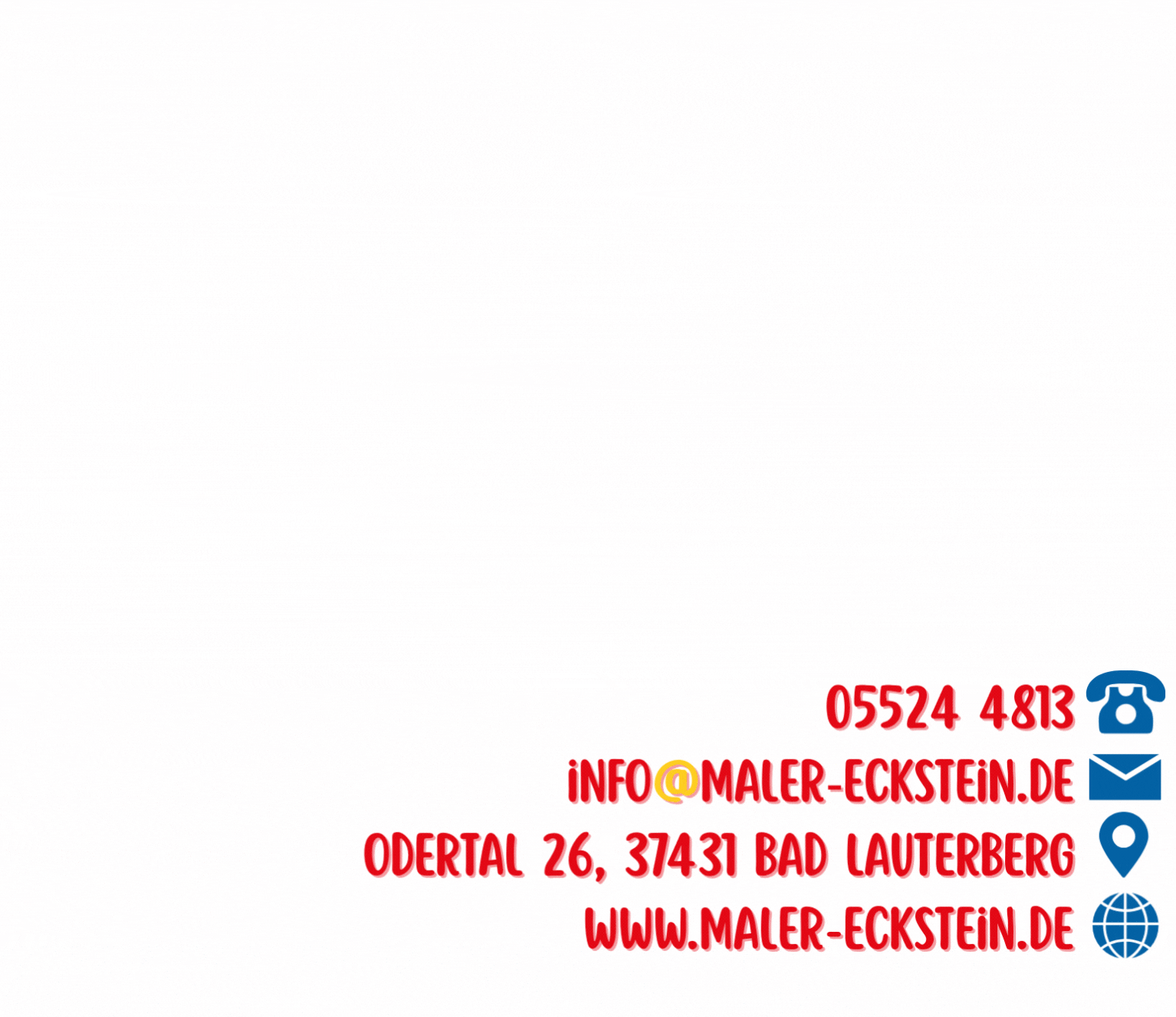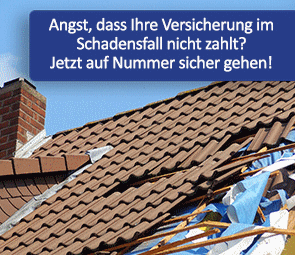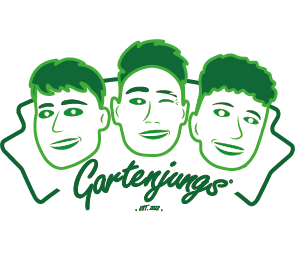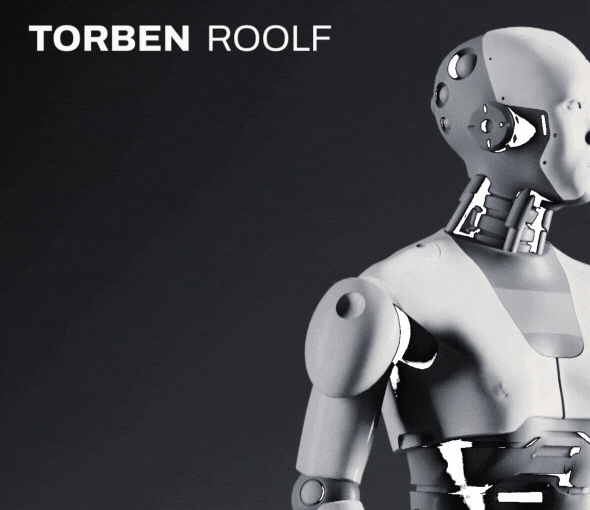Auf dem ganzen Globus gibt es berühmte UNESCO-Welterbestätten: Die Pyramiden von Gizeh, die Chinesische Mauer oder auch der Kölner Dom — diese Baudenkmäler kennt so ziemlich jeder. Nicht so das Oberharzer Wasserregal, auch bekannt als Oberharzer Wasserwirtschaft. Nur wenige Menschen wussten davon – bis 2010, als es die UNESCO ergänzend zum Welterbe Altstadt Goslar und Erzbergwerk Rammelsberg in die Liste der Welterbestätten aufnahm.
Das Harzer Wasserleitsystem gilt mit seinen Kanälen, Teichen und Gräben als eines der bedeutendsten vorindustriellen Energieversorgungssysteme auf der Welt. Es war für den Bergbau jahrhundertelang von größter Wichtigkeit. Dabei lieferte die Oberharzer Wasserwirtschaft bereits vor 800 Jahren Energie für den Bergbau. Im Lauf der Jahrhunderte wurde sie weiter ausgebaut — eine einzigartige Anlage aus kilometerlangen Gräben, Teichen und unterirdischen Wasserläufen entstand.
Die ältesten Teile der Oberharzer Wasserwirtschaft wurden von den Zisterziensern des Klosters Walkenried errichtet und stammen aus dem 12. und 13. Jahrhundert. Seit der frühen Neuzeit bauten die Harzer Bergleute die Anlagen systematisch aus. Sie fingen Regenwasser auf und zapften weit entfernte Bäche an, um es in Stauseen und Auffangbecken umzuleiten. Von dort floss das Wasser weiter durch ober- und unterirdische Wasserläufe zu den Bergwerken.
Regenerative Energienutzung seit dem 16. Jahrhundert
Die Bergleute im Harz nutzten bereits früh die Vorteile der regenerativen Energie: Bereits im 16. Jahrhundert setzten sie auf die Kraft des Wassers, um damit Pumpen und Fahranlagen anzutreiben und so in zuvor unerreichte Tiefen vorzustoßen. Die intensive Nutzung der Wasserkraft war der Erfolgsgarant für den Bergbau im Harz ab der frühen Neuzeit. Das Recht zur Wassernutzung war die Grundvoraussetzung für die weitere Entwicklung — das verdeutlicht bereits die Bezeichnung Wasserregal: Ein Regal war ein vom Landesherrn verliehenes Recht (Regal = “Königsrecht”). Das Wasserregal war also das Privileg zur Wassernutzung für Bergbauzwecke. Alle anderen Wassernutzer, wie beispielsweise Mühlenbesitzer, mussten sich der Vorrangstellung des Bergbaus unterordnen.
Wasserwirtschaft ist ein Meisterwerk der Ingenieurskunst
Dort trieb es Wasserräder an, die wiederum Pumpen zum Laufen brachten, mit denen die Bergleute ihre Stollen trocken legten. Denn das aus dem umliegenden Gestein einsickernde Wasser musste aus den Gruben wieder heraus befördert werden — die Bergleute bekämpften also damals Wasser mit Wasser. Später diente die Wasserkraft auch dazu, die sogenannten Fahrkünste anzutreiben, die dazu dienten, Bergleute und Material in einer Art einfachen Aufzug zu ihren bis zu 600 Meter tiefer gelegenen Einsatzorten zu befördern.
Zwischen 1536 und 1866 entstand so ein ausgeklügeltes System aus rund 500 Kilometern Gräben, 120 Stauteichen, etwa 30 Kilometern unterirdischer Wasserläufe und 100 Kilometern Wasserlösungsstollen — eine ingenieurtechnische Meisterleistung. Sogar die Wasserscheide zwischen Süd- und Nordharz überwand man, um die ertragreichen Clausthaler Gruben mit Wasser und damit mit Energie zu versorgen. Die Stauteiche stellten sicher, dass auch in regenarmen Perioden genügend Wasser für die Gruben bereitstand. Bis ins späte 19. Jahrhundert war die Wasserkraft die einzige Energiequelle für den Abbau von Kupfer, Blei und Silber.
Anlagen der Oberharzer Wasserwirtschaft stehen heute unter Denkmalschutz
Bis 1930 wurden fast alle Harzer Bergwerke geschlossen, das Wasser wurde in den Bergwerken nicht mehr gebraucht. Seit Ender der 1970er-Jahre stehen alle Anlagen des Oberharzer Wasserregals unter Denkmalschutz. Ein Teil der Gräben und Wasserläufe wird für kulturhistorische, touristische und Naturschutz-Zwecke in funktionstüchtigem Zustand erhalten: Im September 2011 begannen die Harzwasserwerke außerdem damit, einige verschüttete Gräben, so etwa Abschnitte des Alten Dammgrabens, wieder freizulegen.
Weitere Teile des Wasserregals dienen heute der Stromerzeugung aus Wasserkraft, so beispielsweise der Rehberger Graben. Sein Wasser treibt sechs kleinere Kraftwerke an. Ein Teil der historischen Stauteiche dient den umliegenden Harzorten zur Trinkwasserversorgung. Die Oberharzer Wasserwirtschaft ist also nicht nur einzigartiges Kulturdenkmal, sondern spielt auch eine wichtige Rolle im Alltag der Bewohner.
Für Interessierte, die die alten Anlagen näher erkunden möchten, bieten sich einzelne Teilstücke sehr gut für Wanderungen an. Die früher für den Harzer Bergbau so unverzichtbaren Bauwerke bilden heute auf einer Fläche von 95 Quadratkilometern eine zauberhafte Teich- und Seenlandschaft. An den kilometerlangen Gräben führen romantische Wasserwanderwege entlang. Insgesamt gibt es 22 davon. Sie führen an Anlagen des Wasserregals vorbei. Die Wanderwege sind mit einem Kehrrad als Symbol gekennzeichnet. Schilder am Wegesrand veranschaulichen die Funktionen der historischen Bauwerke.
Interessante Beispiele sind der Dammgraben aus dem 18. Jahrhundert, der das Wasser aus der Brocken-Region zu den Gruben im 25 Kilometer entfernten Clausthal führte und der rund 300 Jahre alte Rehberger Graben, der Wasser des Oderteichs zu den Bergwerken in Sankt Andreasberg leitete. Dort trieb das Wasser ab dem 19. Jahrhundert die Fahrkunst der Grube Samson an, zu ihrer Betriebszeit eines der tiefsten Bergwerke der Welt. Heute ist die Grube, die von 1521 bis 1910 in Betrieb war, ein Schaubergwerk.
Auch ungeübte Wanderer können sich an den Rundwegen erfreuen
Die meisten Touren sind als Rundwege angelegt und mit Längen zwischen 450 Metern und 12 Kilometern auch für ungeübte Wanderer gut zu bewältigen.
Empfehlenswert ist etwa der fünf Kilometer lange Rundwanderweg “Buntenbocker Teiche”, der an fünf historischen Bergbauteichen vorbeiführt. Historisch interessant ist auch die 10,5 Kilometer lange Route “Alter Dammgraben”. Der Wasserwanderweg
“Hirschler Teich und Pfauenteiche” führt wiederum an einer östlich von Clausthal gelegenen Teichkaskade vorbei.
Badespaß im Welterbe – ein Freizeitvergnügen der besonderen Art
Der Sommer wartet für Besucher der Welterbestätte im Oberharz mit einem ganz besonderen Erlebnis auf:
In rund 50 Teichen des Wasserregals, teilweise mitten im Wald gelegen, darf man baden. Auch in einigen Talsperren ist Baden und Wassersport erlaubt. Trinkwasserschutzgebiete und Naturschutzbereiche sind hingegen entsprechend gekennzeichnet.
Foto: Pixabay